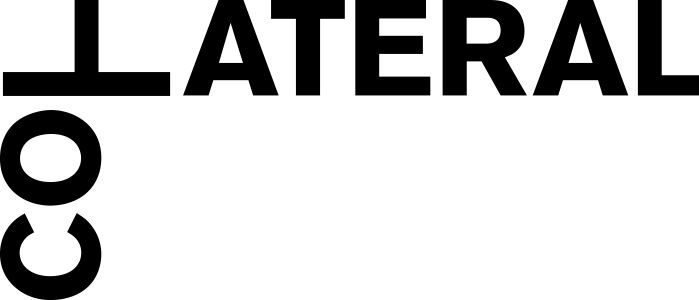40 — November 2019
VERSUCH ÜBER ÖNAN.
ER nichts als ER, oder: Wie pensionsreif1ist die althergebrachte Literatur made in A? Eine ERregung.
Clemens Ruthner
[ Dieses Pamphlet wurde vor gut 20 Jahren verfasst und erregte damals den Zorn von Leser*innen einer steirischen Kulturzeitschrift. Aus gegebenem Anlass sei es mit einigen Fußnoten neu herausgegeben.]
“Ausscheren aus dem Denkdrehkäfig, schweigen.”
(P. Handke)
Am Rand von Groß-Paris sitzt ein in die Jahre gekommener österreichischer expatriate in seinem Einfamilienhaus und versucht trotzig wie ein stark gealterter John Lennon auszusehen. Die Atmosphäre: erdschwer bis bedeutungsschwanger, mitunter ungehalten, wenngleich ohne Mörder. Ab und zu taucht ein anderer Schreiber auf, um einen Brosamen von SEINEM Tisch aufzupicken.
Vor geraumer Zeit schon hat ER es vorgezogen, in einen Vorort zu ziehen, der dem gefährlichen Namen Banlieue keine besondere Ehre macht; eher handelt es sich um eine Art französischer Wienerwald. Hier konnte der ausgepowerte Literatur-Popstar weiterhin nach dem feuchten Traum des Banalen haschen, sein sentimentales Heimkino im Kopf inszenieren, angenehm regressiv.
Es gab Zeiten, da hatte ER noch etwas zu sagen. Dann jedoch machte sich der Geschichtenerzähler durch SEINE unkritischen Schwärmereien für einen Krieg führenden Balkan-Staat unmöglich, in dem ER die “Indianer” Europas sah und deren Häuptling ER im internationalen Untersuchungsgefängnis besuchte. ER indes sah lieber an den Massengräbern vorbei auf die edlen Wilden und die Blumen am Wegesrand, bis es auch vielen seiner alten Fans zu bunt wurde. Daraufhin zog ER sich in seinen französischen Schmollwinkel zurück und galt als unbelehrbar; ein Fels für seine Jünger in der Brandung der West-Medien.2
Hier in der Banlieue konnte er zum Beispiel ungestört SEINEN Science-Fiction-Schlüsselroman über das Schwammerlsuchen drechseln. Das zusammengestoppelte Buch spielt 1997 - echt gewagt! - mit einem deutschen Bürgerkrieg im Hintergrund, von dem niemand die genauen Ursachen und Ereignisse kennt (gelegentlicher Ausruf des Wortes Jugoslawien). Dagegen ist Adalbert Stifter, SEIN Vorbild dem Common Sense nach, nachgerade ein Psychothriller. Aber Hauptsache, es war für jeden was drinnen, der in dieser Niemandsbucht und später in morawischer Nacht an Land ging.
Seine folgenden Bücher, als rezeptpflichtige Barbiturate in der Druckerpresse auf ihr dreifaches Volumen gestreckt, mit Großdruck auf Gabentische gehievt: Abgelegen, im Magen gelegen, gelesen, in die Bestsellerlisten gepusht, um den armen Urheber nicht noch mehr zu frustrieren. Solange, bis ER schlussendlich unlängst einen Ort der Stille - oder vielmehr ein stilles Örtchen – fand: als den wahren Helden seines Schreibens, oder zumindest als Genius loci.
Ein alter Literatur-Nachrichter mit polnischen Wurzeln hat freilich eine brutale Geschmackssicherheit bewiesen, so wie einige andere Kritiker-Kollegen, deren Blick zumindest ungetrübt blieb. Andere verharrten in unbegreiflicher Adoration jenes “Täters des Wortes”, seine “milde Ironie” und “romantische Sehnsucht” verkennend, die doch nur Camouflage sind für die volkschülerhafte Metaphysik eines chronisch humorlosen Selbstbespieglers.
Der Abschied des Großpariser Säulenheiligen vom Feuchtbiotop der österreichischen Literatur wird hingegen immer länger. “Goethe ist tot, Flaubert ist tot, und mir ist auch schon ganz schlecht” war schon das unausgesprochene Credo jener “Versuche”, wie unser Nationalpoet die kreativen Lücken nennt, die sich zwischen SEINEM auf- und abebbenden Prosa-Krampf auftaten. Mehrmals hat ER es “versucht” in den letzten Jahrzehnten, um uns schließlich das Weiße in seinen Augen lesen zu lassen - ebenso wie sein Verlag peinlicherweise die Schrift- und Zeichenproben seines Wunderkindes.
Die dazugehörigen Begeisterungsstürme erforderten da schon viel poststrukturalistische Windmacherei. Dort paarten sich nämlich eher Worte, die eine Wahl zum peinlichsten literarischen Satz im 20. Jahrhundert verdient hätten (Gegenkandidat: Hesse?), wie z.B.: “selten schaffe ich mit meinem Gartentun jenen Puls der Vielfalt.”3
Um IHN in Hinkunft endlich von seinem verbrauchten Martyrium zu erlösen, tun sich zwei gangbare Wege auf. Der erste erscheint masochistisch, aber konsequent: Es gibt möglicherweise immer noch Themen, die einen literarischen Versuch wert wären - wie sagte ER im Gespräch mit Herbert Gamper (1986) so schön: “es ist mir einfach nicht recht, daß ich im Kurzen Brief zum langen Abschied da eine Onanie-Szene beschreibe - ob die erfunden ist oder authentisch, das ist ja egal”.
Die Alternative: eine österreichische Staatsrente nach mehr als 50 Dienstjahren im Druck der bundesdeutschen Wortvermarktung, die jedes Jahr angeschlichen kommt, um dem armen Vertragsautor ein weiteres Buch abzupressen. Eine milde Altersutopie, um den zerfressenen Schmerzensmann vom pathetischen “Hin und Her zwischen Ausweglosigkeit und seelenruhigem Weitermachen” zu befreien. Die österreichische Literatur - so ihr althergebrachter Hype des inneren Exotismus in deutscher Sprache nicht der Globalisierung anheimgefallen ist - schreiben längst andere.4
Anmerkungen
- 1Oder: nobelpreisreif?
- 2Oder sollten wir von ‘Marmorklippen‘ sprechen?
- 3Der Nobelpreis müsste ihm nicht nur aus politischen, sondern auch aus stilistischen Gründen verwehrt bleiben.
- 4Aber die Lippen zur Vergangenheitsverweigerung presst er im Chor mit einem großen Untoten Österreichs dünn zusammen - ein Stellvertreterkrieg in der Waldheimat von Srebrenica.