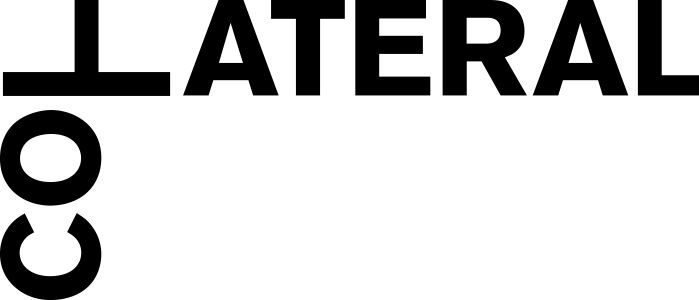21 – December 2019
clustered | unclusteredFor European renewal
Emmanuel Macron
Citizens of Europe,
If I am taking the liberty of addressing you directly, it is not only in the name of the history and values that unite us. It is because time is of the essence. In a few weeks’ time, the European elections will be decisive for the future of our continent.
Never, since the Second World War, has Europe been as essential. Yet never has Europe been in so much danger.
Brexit stands as the symbol of that. It symbolises the crisis of Europe, which has failed to respond to its peoples’ needs for protection from the major shocks of the modern world. It also symbolises the European trap. The trap is not being part of the European Union. The trap is in the lie and the irresponsibility that can destroy it. Who told the British people the truth about their post-Brexit future? Who spoke to them about losing access to the European market? Who mentioned the risks to peace in Ireland of restoring the former border? Nationalist retrenchment offers nothing; it is rejection without an alternative. And this trap threatens the whole of Europe: the anger mongers, backed by fake news, promise anything and everything.
We have to stand firm, proud and lucid, in the face of this manipulation and say first of all what Europe is. It is a historic success: the reconciliation of a devastated continent in an unprecedented project of peace, prosperity and freedom. We should never forget that. And this project continues to protect us today. What country can act on its own in the face of aggressive strategies by the major powers? Who can claim to be sovereign, on their own, in the face of the digital giants? How would we resist the crises of financial capitalism without the euro, which is a force for the entire European Union? Europe is also those thousands of projects daily that have changed the face of our regions: the school refurbished, the road built, and the long-awaited arrival of high-speed Internet access. This struggle is a daily commitment, because Europe, like peace, can never be taken for granted. I tirelessly pursue it in the name of France to take Europe forward and defend its model. We have shown that what we were told was unattainable, the creation of a European defence capability and the protection of social rights, was in fact possible.
Yet we need to do more and sooner, because there is the other trap: the trap of the status quo and resignation. Faced with the major crises in the world, citizens so often ask us, “Where is Europe? What is Europe doing?” It has become a soulless market in their eyes. Yet Europe is not just a market. It is a project. A market is useful, but it should not detract from the need for borders that protect and values that unite. The nationalists are misguided when they claim to defend our identity by withdrawing from Europe, because it is the European civilisation that unites, frees and protects us. But those who would change nothing are also misguided, because they deny the fears felt by our peoples, the doubts that undermine our democracies. We are at a pivotal moment for our continent, a moment when together we need to politically and culturally reinvent the shape of our civilisation in a changing world. It is the moment for European renewal. Hence, resisting the temptation of isolation and divisions, I propose we build this renewal together around three ambitions: freedom, protection and progress.
Defend our freedom
The European model is based on the freedom of man and the diversity of opinions and creation. Our first freedom is democratic freedom: the freedom to choose our leaders as foreign powers seek to influence our vote at each election. I propose creating a European Agency for the Protection of Democracies, which will provide each Member State with European experts to protect their election process against cyber attacks and manipulation. In this same spirit of independence, we should also ban the funding of European political parties by foreign powers. We should have European rules banish all incitements to hate and violence from the Internet, since respect for the individual is the bedrock of our civilisation of dignity.
Protect our continent
Founded on internal reconciliation, the European Union has forgotten to look at the realities of the world. Yet no community can create a sense of belonging if it does not have bounds that it protects. The boundary is freedom in security. We therefore need to rethink the Schengen area: all those who want to be part of it should comply with obligations of responsibility (stringent border controls) and solidarity (one asylum policy with the same acceptance and refusal rules). We will need a common border force and a European asylum office, strict control obligations and European solidarity to which each country will contribute under the authority of a European Council for Internal Security. On the issue of migration, I believe in a Europe that protects both its values and its borders.
The same standards should apply to defence. Substantial progress has been made in the last two years, but we need to set a clear course: a treaty on defence and security should define our fundamental obligations in association with NATO and our European allies: increased defence spending, a truly operational mutual defence clause, and the European Security Council with the United Kingdom on board to prepare our collective decisions.
Our borders also need to guarantee fair competition. What power in the world would accept continued trade with those who respect none of their rules? We cannot suffer in silence. We need to reform our competition policy and reshape our trade policy with penalties or a ban in Europe on businesses that compromise our strategic interests and fundamental values such as environmental standards, data protection and fair payment of taxes; and the adoption of European preference in strategic industries and our public procurement, as our American and Chinese competitors do.
Recover the spirit of progress
Europe is not a second-rank power. Europe in its entirety is a vanguard: it has always defined the standards of progress. In this, it needs to drive forward a project of convergence rather than competition: Europe, where social security was created, needs to introduce a social shield for all workers, east to west and north to south, guaranteeing the same pay in the same workplace, and a minimum European wage appropriate to each country and discussed collectively every year.
Getting back on track with progress also concerns spearheading the ecological cause. Will we be able to look our children in the eye if we do not also clear our climate debt? The European Union needs to set its target – zero carbon by 2050 and pesticides halved by 2025 – and adapt its policies accordingly with such measures as a European Climate Bank to finance the ecological transition, a European food safety force to improve our food controls and, to counter the lobby threat, independent scientific assessment of substances hazardous to the environment and health. This imperative needs to guide all our action: from the Central Bank to the European Commission, from the European budget to the Investment Plan for Europe, all our institutions need to have the climate as their mandate.
Progress and freedom are about being able to live from your work: Europe needs to look ahead to create jobs. This is why it needs not only to regulate the digital giants by putting in place European supervision of the major platforms (prompt penalties for unfair competition, transparent algorithms, etc.), but also to finance innovation by giving the new European Innovation Council a budget on a par with the United States in order to spearhead new technological breakthroughs such as artificial intelligence.
A world-oriented Europe needs to look towards Africa, with which we should enter into a covenant for the future, taking the same road and ambitiously and non-defensively supporting African development with such measures as investment, academic partnerships and education for girls.
Freedom, protection and progress. We need to build European renewal on these pillars. We cannot let nationalists without solutions exploit the people’s anger. We cannot sleepwalk through a diminished Europe. We cannot become ensconced in business as usual and wishful thinking. European humanism demands action. And everywhere, the people are standing up to be part of that change. So by the end of the year, let’s set up, with the representatives of the European institutions and the Member States, a Conference for Europe in order to propose all the changes our political project needs, with an open mind, even to amending the treaties. This conference will need to engage with citizens’ panels and hear academics, business and labour representatives, and religious and spiritual leaders. It will define a roadmap for the European Union that translates these key priorities into concrete actions. There will be disagreement, but is it better to have a static Europe or a Europe that advances, sometimes at different paces, and that is open to all?
In this Europe, the peoples will really take back control of their future. In this Europe, the United Kingdom, I am sure, will find its true place.
Citizens of Europe, the Brexit impasse is a lesson for us all. We need to escape this trap and make the upcoming elections and our project meaningful. It is for you to decide whether Europe and the values of progress that it embodies are to be more than just a passing episode in history. This is the choice I propose: to chart together the road to European renewal.
Emmanuel Macron
Source: www.elysee.fr
This cluster is the third of a four-part publication series which derives from COLLATERAL's symposium ‘State of the Union’ that took place in Hasselt on the 3rd of May, 2019
a
clustered | unclusteredSimuMacron
Europa als simulacrum
Thomas Decreus
Sinds de herfst van 2018 wordt Frankrijk overspoeld door een ongeziene golf van sociaal protest. Wat begon als een spontane oproep om te protesteren tegen verhoogde accijnzen op brandstof groeide in geen tijd uit tot een opstand die qua intensiteit niet meer gezien was sinds 1968. Een opstand die overigens nog steeds niet voorbij is. Nu, ongeveer een jaar nadat de Gilets Jaunes voor het eerst post vatten op rotondes en kruispunten, komen ze nog steeds iedere zaterdag op straat. Hoewel er geen sprake is van een coherent programma of een eisenbundel, is het niet moeilijk om te achterhalen waar het protest om draait. Zij die een geel hesje aantrekken zijn zij die aan het einde van de maand de rekeningen niet betaald krijgen, die iedere dag honderden kilometers rijden voor een interimjob, die zich geografisch, sociaal en maatschappelijk gezien aan de periferie bevinden.
Vanaf dag één heeft de Franse overheid ingezet op repressie. Die repressie uitte zich onder meer in fysiek geweld tegenover demonstranten. Dat geweld had niet alleen het doel om betogers uiteen te drijven, maar ook om hen te verwonden en zo de rest van de beweging te ontmoedigen. Een ander luik van de repressie bestond uit het verspreiden van desinformatie door de overheid en gevestigde media. De Gilets Jaunes werden bijvoorbeeld weggezet als antisemieten, racisten of homofoben. Iedere week opnieuw werd aangekondigd dat de beweging op het punt stond in elkaar te stuiken. Bovendien werden er van overheidswege cijfers verspreid die niet overeenkwamen met de reële opkomst tijdens manifestaties. De staat verspreidde ook actief leugens. Christophe Castaner, de Franse Minister van Binnenlandse Zaken, durfde na maanden van politiegweld zonder verpinken te beweren dat de politie zich nooit te buiten is gegaan aan excessief geweld. Diezelfde Castaner lanceerde kort na de 1 mei-betoging ook via Twitter het gerucht dat betogers een Parijs ziekenhuis waren binnengedrongen en daar schade hadden aangericht terwijl ze op zoek waren naar gewonde agenten. De waarheid was dat betogers hun toevlucht hadden gezocht tot het ziekenhuis omdat ze op de vlucht waren voor politiecharges.
Er werd me gevraagd om de brief van Macron aan de burgers van Europa van commentaar te voorzien. Ik zou kunnen doen wat van mij verwacht wordt, namelijk ingaan op de tekst, die analyseren en de woorden van Macron wegen om daarna tot conclusies te komen. Ik zou, met andere woorden, de brief van Macron te goeder trouw moeten lezen, als de brief van iemand die meent wat hij zegt, die in zijn woorden gelooft en als oprecht moet worden beschouwd tot het tegendeel duidelijk bewezen is. Die startpositie is de voorwaarde voor de mogelijkheid tot degelijke politieke interpretatie en, uiteindelijk, politieke kritiek. Maar het is moeilijk, om niet te zeggen onmogelijk, om die startpositie in te nemen. Daarvoor is de discrepantie tussen de woorden en de toon van Macron in zijn brief en de binnenlandse reactie tegenover de Gilets Jaunes eenvoudigweg te groot.
Ik ben me er welbewust van dat er altijd een onvermijdelijke kloof gaapt tussen zelfrepresentatie en handeling, tussen voornemen en uitvoering of tussen retoriek en beleid. Die kloof is de plaats waar debat en discussie kunnen ontstaan en is in die zin, vanuit democratisch oogpunt, ook een vruchtbare plaats die moet worden gekoesterd. Maar de afstand tussen retoriek en handeling kan ook dermate groot worden dat er geen connectie meer kan worden gemaakt tussen beide en dat de criticus in een tweespalt terechtkomt. Welke Macron moet immers bekritiseerd worden? De Macron die een brief schrijft aan de Europese burgers of de Macron die diezelfde burgers laat neerslaan in de Franse straten? De Macron die in zijn brief het zwaard opneemt tegen desinformatie of de Macron wiens ministers zelf met een zekere gretigheid leugens de wereld insturen? Het is aanlokkelijk om vanuit die diagnose te vervallen in een psychologisch proces. Is Macron een leugenaar? Een zwakke leider die zijn eigen idealen niet kan realiseren? Een manipulator? Een narcist? Of iemand die gewoon vervreemd is van een werkelijkheid die hij verondersteld is te kennen? Het behoort allemaal tot de mogelijkheden, maar ieder antwoord kan pas geformuleerd worden na een doorlichting van Macron als persoon. Dat is niet meteen de meest interessante oefening omdat politiek en politieke kritiek op die manier gereduceerd worden tot de psychische gesteldheid van een individu.
Ik denk daarom dat de kloof tussen representatie en realiteit – of liever, het complete uiteengroeien van die twee velden, waardoor we ook niet langer kunnen spreken over ‘representatie’ tegenover ‘realiteit’ – moet worden geïnterpreteerd als symptoom van een bredere politieke evolutie. Het valt immers niet te ontkennen dat de loskoppeling van beide velden een algemeen fenomeen is. Via hun eigen mediakanalen weten politici en propagandisten vandaag een eigen realiteit te scheppen waarin problemen, oplossingen en diagnoses worden geformuleerd die soms heel weinig van doen hebben met de concrete, geleefde maatschappelijke werkelijkheid. Om een voor de hand liggend voorbeeld te geven: het idee dat Europa overspoeld wordt door vluchtelingen klopt de facto niet. Maar het beeld wordt wel gecreëerd, vindt ingang, wordt gemultipliceerd, geeft sommige politici vleugels, doet verkiezingen winnen en regeringen vallen. Maar in laatste instantie blijft het een beeld dat nauwelijks overeenstemt met een realiteit.
Politiek is vandaag in hoge mate simulacrisch geworden. Zoals Jean Baudrillard betoogt, is een simulacrum een representatie zonder referent, een kopie zonder origineel, die op zichzelf staat, slechts verwijst naar andere representaties en zo een eigen universum vormt. Kan Macron vanuit dit opzicht zelf niet als een simulacrum beschouwd worden? Is de Macron die we te zien krijgen geen permante simu-Macron? Iemand wiens woorden en handelingen enkel steek houden binnen een zelfreferentieel universum? Macron is in ieder geval iemand die er altijd in slaagt om een wel bepaald beeld van zichzelf ingang te laten vinden. Al zijn campagnes zijn gebaseerd op het hooghouden van een imago: dat van sterke staatsman, monarch-manager, bevlogen leider, redder van de door populisten belaagde republiek, belichaming van een nieuwe liberale redelijkheid, Franse grandeur en kosmopolitische openheid. Toen hij net verkozen was, waren de meeste krantenkoppen unaniem: Macron zou Europa redden van de populisten, was een deus-ex-machina die het politieke centrum zou vrijwaren van aanvallen vanop de linker- en rechterflanken en zou het blazoen van Frankrijk opnieuw oppoetsen. Niemand herinnerde zich echter dat diezelfde Macron een product was van de traditionele Franse elite en eerder als minister gediend had onder de regering van Hollande, die aan straatprotest ten onder ging.
In de lijn van de figuur van Macron zelf kan ook zijn brief aan de burgers van Europa geïnterpreteerd worden als een simulacrum. Het is een brief die niemand in zijn brievenbus wenste, geschreven door een redder waar niemand op te wachten zit. De hoogdravendheid en de overtuiging van het eigen historische belang zijn in feite uitdrukking van een uitgekiende communicatiestrategie en creëren slechts de illusie van doortastend staatsmanschap. Die illusie werd gereproduceerd door de media die de brief mochten afdrukken op hun opiniepagina’s. Enkel op die pagina’s was de publicatie een event, een oproep die historisch en belangrijk werd genoemd. Ook de geadresseerden, de burgers van Europa, zijn immers een simulacrum: er zijn geen burgers van Europa, niet in de formele juridische zin en evenmin in de vorm van een zelfbewuste, collectieve identiteit. Dit staat los van de vraag of een dergelijke identiteit gewenst is of niet.
Wat Macron probeert te doen in zijn brief is het simulacrum van een Europees volk met een zelfbewuste identiteit geloofwaardig en overtuigend te maken. Het discours dat hij daarvoor gebruikt bevat dezelfde ingrediënten als dat van de nationalisten die hij beweert te bestrijden: het opwekken van misplaatste trots en onterechte angst. In de brief van Macron verschijnt Europa als een verheven beschaving waar “we” trots mogen op zijn. “Europa is geen tweederangs mogendheid. Heel Europa vormt een voorhoede (...)”, zo stelt Macron. En nog: “Het Europese model berust op de vrijheid van de mens, de verscheidenheid van meningen en de scheppende kracht.” Maar die uitzonderlijke Europese beschaving staat tegelijk op het spel, zo laat Macron voortdurend uitschijnen in zijn open brief. Bij “elke stemming [trachten] buitenlandse mogendheden onze stemmen te beïnvloeden” en ten aanzien van “de migratiestromen” is er een Europa nodig dat “zowel zijn grenzen als zijn waarden bewaakt”.
Wat overblijft is het beeld van een superieure maar tegelijk bedreigde samenleving die haar eenheid moet hervinden om niet aan externe dreigingen ten onder te gaan. Dat is het basisschema waarop het pleidooi van Macron terug te voeren valt. De dreiging ten aanzien van iets wat er niet is – een Europese beschaving, Europese burgers, enzovoort – moet datgene wat niet is tot iets wat is maken. Het is een performatieve houdgreep die het simulacrum met alle macht van een referent probeert te voorzien. En misschien is dat ook hoe Europa zelf moet worden begrepen, of althans het geheel van instellingen dat beweert te spreken namens Europa. Vanaf het prille begin proberen die instellingen een Europa te construeren waarvan ze zelf de vertegenwoordiger claimen te zijn.
Het is een andere manier om aan te geven dat Europa een geconstitueerde macht is zonder constituerende macht. Het onderscheid tussen een constituerende en geconstitueerde macht maakt een vast onderdeel uit van de democratische verbeelding. De geconstitueerde macht – de gevestigde instellingen – worden aanzien als voortvloeiend uit een constituerende macht – het volk – die nooit volledig samenvalt met de geconstitueerde macht. Het Europa van de Europese instellingen is een geconstitueerde macht die vanaf zijn ontstaan op zoek is geweest naar een constituerende macht om zich een aura van democratische legitimiteit aan te meten. Het is een zoektocht die gedoemd is om te falen omdat een constituerende macht logischerwijs voorafgaat aan de geconstitueerde macht. Die volgorde proberen om te draaien eindigt steevast in de reproductie van een similacrum. Dat is het drama van Europa. En van Macron. En misschien zelfs van iedere politiek vandaag.
b
clustered | unclusteredReturned to sender: Macron’s letter to the Citizens of Europe
Louise Hoon
A few weeks ahead of the latest European Parliament (EP) elections, French President Emmanuel Macron made a direct appeal to the Citizens of Europe in an almost personal letter, published in 28 different European newspapers. Evoking a context of existential threats from the in- and outside of the European Union, Macron begged European citizens to use their vote wisely. He didn’t specifically encourage them to vote for Renew Europe, the liberal alliance he joined shortly before the election (previously ALDE), but he did make it very clear how they should not vote: for one of the Eurosceptic, nationalist and populist parties.
Two years after the United Kingdom voted to leave the EU, the risks and difficulties of returning to the politics of national boundaries seemed to be dawning on European citizens. Since the Brexit referendum, support for European integration had been on the rise in the remaining member states. Also, Eurosceptics like Marine Le Pen and Geert Wilders, who previously campaigned loudly for a ‘Nexit’ or a ‘Frexit’, became remarkably silent on the idea of leaving the EU. In that light, the 2019 European Parliament elections were expected to call a halt to the rise of Eurosceptic and populist nationalism. Macron’s letter was an outspoken appeal to citizens to do so.
But did they? The election outcome does not provide a clear answer to that question. Yes, voter turnout increased with 5%. This historic surge indicates that citizens shared the sense of urgency expressed in the letter. Also, the clearest winners of the election were expressively pro-European political parties. The Greens took 24 additional seats and now hold 74 of the 751 seats in the European Parliament. Joined by Macron’s Renaissance, the progressive liberals of Renew Europe gained 41 seats compared to 2014, taking up 108 in total.
However, the ground gained at the pro-European side was not lost at the Eurosceptic side of the Parliament’s hemicycle. The Identity and Democracy alliance, a fortified version of the Eurosceptic and nationalist Europe of Nations and Freedom (36 seats in the previous legislature), won 74 seats. Summing up their seat share to that of the European Conservatives and Reformists (62 seats), the radical left European United Left – Nordic Green Left (41 seats) and a number of unaffiliated Eurosceptic members, about a fourth of the EP’s seats remain in the hands of Eurosceptics. That amount is comparable to the Eurosceptic seat share after the 2014 election, which was received as a ‘Eurosceptic earthquake’.
The real losses were suffered at the center. The Christian-democrat European People’s Party (EPP) and the social-democrat Socialists and Democrats (S&D) lost their majority in the parliament. This is a significant event, as European integration and decision-making have depended on the close cooperation and compromise of the Chistian- and social-democrat party families in and around the EU institutions.
The divided outcome shows that Macron’s appeal may have pushed some voters to switch from the center to a more pro-European alternative. But it didn’t convince Eurosceptics to change their mind, nor did it bring Europeans closer together in a renewed effort for European integration.
This short essay identifies three aspects that may explain why Eurosceptic citizens were not convinced and returned the letter to its sender. From a broader perspective, it tells us something about the problems with the discourse by which pro-European elites attempt to get citizens back on board.
Address unknown. No such number, no such zone
A first crucial aspect of Macron’s address to European citizens is its form. The French President could have provided his arguments for a stronger and more united Europe in any type of text, but he chose to address them personally and directly in a letter, headed “Dear European citizens”. This strategy allows him to define his readers from the first line as one people, with a common history and future. The problem, however, is that Macron fails to define these citizens in concrete, political and cultural terms, thus sending out a letter without addressee.
For a particular group of readers, European citizenship may be as self-evident as it is for Macron himself. These are often citizens who have reaped the benefits of open borders and market integration. But those who are more skeptical, or do not adhere to Europe as they do to their national country (yet), are unlikely to feel addressed by these opening words. Further along the lines of his text, Macron correctly remarks that many citizens ask themselves “where is Europe? What is Europe doing?” and that it has become a “soulless market” to them. But his letter doesn’t offer a substantial answer to this question.
Like many other pro-European elites, Macron borrows his ideal of European citizenship from a neo-functionalist perspective on European integration. Simply put, this framework considers European integration as a process of optimization of markets and governance, with nothing but economic and efficiency gains for the member states. A win-win, which can only be received with open arms by citizens. As economic and efficiency gains spill over into more economic and efficiency gains, the self-evident direction is more and deeper integration.
From this perspective, European citizenship is a mere privilege, and those who do not value it are either ignorant or poorly informed. Another consequence of this approach is that many pro-European elites seem to believe that getting citizens back on board of the European project is mainly a matter of marketing and communication. This withholds them from reflecting on fundamental institutional, democratic and political reform.
Citizenship can impossibly be defined merely by economic and efficiency gains alone, nor by the – undeniably important – achievements of peace, prosperity and freedom. Doing so, one neglects the fact that European integration and European policy, like all political choices, inevitably have winners and losers. While highly educated citizens enjoyed their Erasmus exchange, lived, worked and spent their holidays easily across the EU’s borders, less affluent and lower-skilled citizens faced the drawbacks of social dumping and increased competition on the labor and housing market. It makes sense that the first group feels spoken to by “Dear European citizens”, but that the second group doesn’t.
For many citizens, in addition, European citizenship lacks emotional content and a cultural dimension, contrary to national citizenship. Common traditions, art, popular culture and language remain very much confined to national borders. As a part of all that, so does political debate and participation. Thus, it is a task of political elites, as well as of artists, writers, journalists, educators and citizens to expose European citizens to the ample links, overlaps and intersections of national and regional cultures in Europe, and to create the fabric for a transnational, European political debate.
It is true, as Macron puts it in his letter, that “retreating into nationalism offers nothing”. But for many, nationalism still holds a sense of belonging to a political system, of being part of something larger than oneself. For many, nationalism and identity are key aspects of citizenship, and thus a foundation of their trust in the political system and of their willingness to participate, compromise and contribute. Therefore, European citizenship cannot come about in the identity vacuum of neo-functionalism, or in the abstract terms of freedom, democracy and progress. Nor should it be a counter-reaction to, or a rejection of other forms of cultural, national, regional and inter- and extra-European migrant identities. Only if leaders like Macron can give cultural and political meaning to European citizenship, citizens will feel addressed by “Dear Citizens of Europe”.
This time, it’s really, really for real
A second aspect of the letter, which resonated in pro-European campaigns all over Europe ahead of the 2019 elections, was the idea that this one election would crucially define the future of Europe. Throughout the letter, Macron stresses how citizens have the possibility to safe the EU from the destruction and downfall that nationalists and Eurosceptics propose.
We may ask ourselves how fair and useful it is to use this sense of urgency to push Europeans to vote for a Parliament that is hardly taken seriously by political leaders like Macron himself. First and foremost, the importance of voting in an election should not be defined by the level of crisis a political system is suffering. Secondly, the European Parliament had already used similar phrases ahead of the 2014 election; “this time, it’s different” was the title of a new procedure by which citizens were deceitfully told they could ‘elect’ the next European Commission President.
European Parliament elections are not meaningless. They have a very important function in the establishment of European democracy and political integration, as they show citizens what political issues unite and divide them across national borders. Also, European Parliament elections force political parties to compete along those lines. But the European Parliament is institutionally insufficiently strong, insufficiently representative and internally insufficiently organized to define the future course of the European Union.
Over the years, the Parliament has gradually expanded its legislative competences and its control over the European Commission. But recent crises and division, as well as decades of stagnation in the official integration process have made national governments and leaders de facto much more powerful in the European decision-making process.
Most importantly, European campaigns may be about many issues, but not about the future course of European integration. The power to advance or delay integration remains a crucial and exclusive competence of national governments. In other words, the battle between those who want more, and those who want less Europe is basically situated at the national level.
Eurosceptic and nationalist politicians are blessed by European Parliament elections that revolve around European integration, rather than around EU policy. They have a clear and simple statement on the first topic (contrary to the pro-European parties), and very little to say about the latter. As in 2014, the pro-European camp was pitched against the Eurosceptics and nationalists, which left very little space for meaningful debate within the pro-European camp about the topics that actually matter in European decision-making, and thus to the European Parliament.
Democracy and participation in Macron’s future Europe
In his seminal work Restructuring Europe, Stefano Bartolini describes how democratic political integration only takes place when citizens attain the possibility to voice their demands and interests at a higher political level. When citizens become divided by truly European political issues, they will no longer be divided along the lines of national borders, but over issues like spendings, social rights and environmental policy in the EU as a whole. And vice versa: the more European citizens become divided along the lines of nation states, less they will unite and rally around more substantial policy issues.
President Macron has often expressed awareness of this transnational democratic aspect of political integration. Nevertheless, there are no references to the European Parliament, its role and competences in his letter. As the President of one of the most powerful member states in the EU, Macron has not played a great role in empowering the European Parliament either. He has approached European decision-making as a matter of diplomacy, behind-the-scenes bargaining and power-play between national governments, thus sidelining the Parliament. On several occasions, Macron has also expressed his support for a Europe of Multiple Speeds. In this constellation, certain groups of member states would seek deeper cooperation in specific policy fields, leaving others behind. This idea of integration at multiple speeds also contradicts an enforcement of the European Parliament. As that Parliament is designed to represent the citizens of the EU as a whole, it can impossibly have a say on policy domains that are integrated only for a part of the member states.
In response to those critiques, one may argue that Macron does make a concrete proposal to listen to citizens in his attempt to renew the European integration process. In the letter, for example, he launches the idea of a Conference for Europe, which “will need to engage with citizens panels, and hear from academics, business and worker representatives, as well as religious and spiritual leaders.”
However, such deliberative initiatives are quite sensitive to unequal representation. They tend to attract highly educated, privileged and integration-supportive citizens. Moreover, previous experiences with participative democracy at the European level, such as the European Citizen Initiative and the Citizens dialogues in the framework of the Future of Europe, have also shown that input from such initiatives can easily be put aside by political leaders.
In his letter, as well as in his wider discourse, President Macron often presents political participation as a moral duty. At the same time, he leaves little space for types of participation and programs that do not fit his own view on French and European society. Whether it is classic party politics, activism, protest voting or voting for nationalist and Eurosceptic parties, all are written off as backward, outdated and often illegitimate ways of participating.
This attitude has marked Macron’s reactions to other outspokenly political, transnational initiatives, such as the Gilets Jaunes protest movement in France. Confronted with youngsters organizing school strikes to call leaders’ attention to the climate crisis, he remarked that he would rather see them get out and “clean up beaches in Sicily”.
Rather than presenting himself as a neutral father-figure, pointing out the ‘right’ direction to citizens, we may conclude that President Macron would have served European democracy better by overtly campaigning for the liberal Renew group in the European Parliament. In his attempt to build bridges between pro-European and Eurosceptic citizens, he has probably created more division then unity.
Presenting European citizenship as self-evident, and as nothing but a privilege, he may speak to those who are already convinced of the benefits of European integration but fails to convince those who experience the downsides of it. In order to get Eurosceptic citizens back on board, we need a discourse that defines European citizenship in more concrete cultural and socio-economic terms. Only when European election campaigns are overtly political, and revolve around the stakes in European decision-making, will it make sense to tell citizens that the future of Europe is in their hands.
c
clustered | unclustered“Burgers van Europa”
Bedenkingen bij de retoriek van verbondenheid
Astrid Van Weyenberg
Begin maart 2019, kort voor de Europese verkiezingen, richt Emmanuel Macron het woord tot de burgers van Europa. Op de opiniepagina’s van kranten in alle 28 EU-lidstaten verschijnt een dramatische brief waarin de Franse president oproept tot “de Vernieuwing van Europa” (pour une Renaissance européenne), waarbij het gebruik van een kapitaal het belang van deze Vernieuwing voor “de toekomst van ons continent” moet onderstrepen.1 Volgens Macron is het beslissende moment aangebroken “waarop we collectief de vormen van onze beschaving in een politiek, cultureel veranderende wereld opnieuw moeten uitvinden”. En zo blijkt de ogenschijnlijk progressieve roep om vernieuwing eigenlijk een conservatieve wanhoopskreet over een Europa dat sinds de Tweede Wereldoorlog “nog nooit zo in gevaar” en “nog nooit zo noodzakelijk” was.
Macrons wanhoopskreet staat niet op zichzelf. Verschillende Europese politieke en culturele instanties hebben zich de afgelopen jaren gebogen over manieren om de burgers van Europa aan te spreken met een nieuw verhaal voor en een nieuwe visie op Europa. Het Huis van de Europese Geschiedenis, een museum dat in 2017 zijn deuren opende in het hart van de Europese wijk in Brussel, is hier een goed voorbeeld van. Het museum was een initiatief van het Europees Parlement (dat ook de niet geringe ontwikkelingskosten van circa 55,4 miljoen Euro voor zijn rekening nam) en had de intentie om Europa te verankeren in een gedeeld verhaal. Nu Europa niet langer als het politieke en geografische middelpunt van de wereld functioneert, lijken ‘we’ meer en meer behoefte te hebben aan een verhaal dat ‘ons’ zou moeten helpen onze Europese identiteit opnieuw vorm te geven.
De grondslag voor dit alles is de overtuiging dat Europa in diepe crisis verkeert. In het Huis van de Europese Geschiedenis is dat minder expliciet dan in Macrons brief, maar wie de veel gestelde vragen (FAQs) over het Huis op de website van het Europees Parlement leest, ziet daar onder andere de vraag “Wat is het doel van een Huis van de Europese Geschiedenis?”. Het gegeven antwoord luidt als volgt: het Huis moet toekomstige generaties helpen begrijpen hoe en waarom de Unie tot stand is gekomen, omdat het “met name in tijden van crisis belangrijk is de cruciale rol van cultuur en erfgoed te benadrukken en eraan te worden herinnerd dat vreedzame samenwerking niet vanzelfsprekend is.” Het is wat ongemakkelijk (en ook onheilspellend) hoe de specifieke “tragedies van de 20ste eeuw” hier worden gekoppeld aan niet-gespecifieerde “tijden van crisis”. Beleven we nu “tijden van crisis” en is dit waarom we behoefte hebben aan een Huis van de Europese Geschiedenis? Zo ja, over welke crises hebben we het dan eigenlijk precies? En is het niet van belang om te erkennen welke rol Europa en, specifieker, de Europese Unie in deze crises speelt?
Macron gebruikt het woord “crisis” als hij, direct aan het begin van zijn brief, de Brexit het symbool noemt van de crisis in Europa. Ook hier blijft het wat vaag wat die crisis precies behelst, maar Europa is er volgens Macron in elk geval niet in geslaagd te reageren op “de behoefte aan bescherming van de volken tegen de grote schokken in de wereld van vandaag.” Even later gebruikt hij deze frase nogmaals als hij het heeft over de burgers die, “geconfronteerd met de grote schokken in de wereld,” politici regelmatig vragen: “Waar is Europa? Wat doet Europa?”. Het is aan de lezer om deze “grote schokken” verder invulling te geven, al heeft Macron het later bijvoorbeeld wel (iets) specifieker over de “crisis van het financiële kapitalisme”, dat volgens hem uitsluitend door de Euro opgelost kan worden.
De crisisretoriek van zowel het Huis van de Geschiedenis als van Macron past binnen het ‘crisisklimaat’ dat in Europa lijkt te domineren. Maria Boletsi legt uit dat de financiële crisis, de crisis van de Eurozone, de vluchtelingencrisis en de angst voor terrorisme allemaal hebben bijgedragen aan een algemeen gevoel van crisis, een gevoel dat vervolgens is gebruikt (en uitgebuit) om allerlei politieke restricties te legitimeren.2 Daarbij wordt een scherp onderscheid gemaakt tussen daders en slachtoffers, schuldigen en onschuldigen, ‘zij’ en ‘wij’, vanuit de valse veronderstelling dat dit onproblematische en eenvoudig in te delen categorieën zijn. Volgens het verhaal van het Huis van de Europese Geschiedenis zijn het vooral de burgers zonder historisch besef die een gevaar vormen, omdat zij de vrede in Europa als iets vanzelfsprekends zien. De remedie is het tentoongestelde historische verhaal over Europa’s turbulente verleden, een verhaal dat culmineert in een vredig en verenigd Europa.
In Macrons brief is de wij/zij-scheiding die door de crisisretoriek in het leven wordt geroepen explicieter. Zijn gebruik van het persoonlijk voornaamwoord ‘wij’ spreekt ogenschijnlijk alle “Burgers van Europa” aan, wat saamhorigheid en eensgezindheid over wat Europa is of zou moeten zijn moet bewerkstelligen. Macron schrijft over de Europese beschaving “die ons verbindt, ons bevrijdt en ons beschermt” en over de noodzaak om “de vormen van onze beschaving opnieuw uit te vinden” en “onze vooruitgangsgedachte” te hervinden. De lezer wordt continu als onderdeel van dit ‘ons’ aangesproken. Aan het eind van de brief adresseert Macron de lezer direct: “Het is aan u om te beslissen of Europa en de vooruitgangswaarden die het in zich draagt, meer moeten zijn dan een voetnoot in de geschiedenis.” Retorisch is dit een goed gekozen einde. Er zullen ongetwijfeld weinig Europese burgers zijn die Europa graag als een voetnoot in de geschiedenis zien. Macron speelt hier in op het wijdverspreide nostalgische idee dat Europa tot voor kort de hoofdrol speelde in de wereldgeschiedenis, maar nu van haar voetstuk is gestoten, de speelbal van andere grootmachten is geworden, haar welvaart en voortrekkerspositie is kwijtgeraakt, enzovoort. De kritische lezer stelt hopelijk vragen over wat deze glansrol voor Europa betekent voor zij die ondergeschikte rollen in dat verhaal toebedeeld kregen of zelfs uit dat verhaal gewist zijn. Op nationaal niveau wordt deze discussie gelukkig meer en meer gevoerd, maar binnen de context van Europa vallen wat dit betreft nog wel wat stappen te zetten.
Door de lezer verantwoordelijk te stellen voor het beschermen van de Europese “vooruitgangswaarden”, creëert Macron een onderscheid tussen ‘wij’ als de beschermers van deze waarden en ‘zij’ die deze waarden bedreigen. Tot dat ‘zij’ behoren volgens Macron in elk geval de “nationalisten”, die “misbruik maken van de woede van de volken” en die daarmee de stabiliteit van de Europese Unie in gevaar brengen. Maar – en hiervan is Macron zich ongetwijfeld bewust – binnen het huidige politieke klimaat roept het woord “vooruitgangswaarden” bij sommige lezers helaas ook andere associaties op, waarbij het ‘zij’ vaak etnisch of raciaal wordt ingekleurd. Zo worden in discoursen over “de Europese beschaving” moslims vaak geclassificeerd als het ‘zij’ dat deze eeuwenoude en superieure beschaving in gevaar brengt. In het gebruik van het voornaamwoord ‘wij’ schuilt, kortom, altijd het gevaar van uitsluiting.
Het is bovendien de vraag of crises (van welke aard dan ook) het best het hoofd worden geboden door een beroep te doen op een gedeelde beschaving, een gedeeld erfgoed, een gedeelde geschiedenis. Ook in het Huis van de Europese Geschiedenis gaat het om het creëren van één verhaal waarin alle Europese burgers zich kunnen vinden. Het idee van een gedeelde geschiedenis wordt daarbij als de kern van ‘Europeesheid’ gepresenteerd. Dit is problematisch, omdat het ten onrechte veronderstelt dat alle Europese burgers een gedeeld erfgoed (kunnen) hebben en daarmee de vele Europeanen wiens Europese verhaal niet begint bij, zeg, het einde van de Tweede Wereldoorlog, uitsluit. Zo ontstaat impliciet een hiërarchie van burgerschap, waarbij sommigen meer “Europeaan” worden gevonden dan anderen, of – om de problematische metafoor van het huis voort te zetten – waarbij sommigen meer recht hebben in dit huis te wonen en zich er in thuis te voelen dan anderen. Het maakt zichtbaar dat lang niet alle burgers van Europa als Europese burgers worden gezien. Het is dan ook twijfelachtig of het toekomstproject van de EU het best gediend wordt door het te koppelen aan een idee over een gedeelde identiteit, geschiedenis of cultuur.
Het Europese verhaal dat Macron oproept is een verhaal van progressie en integratie. Europa mag dan een crisis doormaken, ‘we’ hoeven er alleen maar voor te kiezen, zo lijkt de boodschap, om de oude vooruitgangsgedachte weer te omarmen. Bewustzijn over onze geschiedenis en trots over onze beschaving zouden hiervoor de grondslag moeten zijn. Ook in het Huis van de Europese Geschiedenis biedt een specifieke interpretatie van het verleden de historische en de morele onderbouwing voor eenwording en integratie. Daarbij is het heden uiteraard geen toevallige uitkomst, maar het resultaat van een gestaag en bewust historisch proces. Interessant is dat het in dit museum duidelijk om het creëren van een transnationaal verhaal gaat, maar dat het gebruik van woorden als “waarden,” “vrede”, “vrijheid” en “vooruitgang” desalniettemin doet denken aan nationale identiteitsretoriek. Macron hanteert vergelijkbare begrippen in zijn brief. Hij stelt Europa voor als een “project” dat verankerd is in “de verzoening van een verwoest continent, met ongeëvenaarde plannen voor vrede, voorspoed en vrijheid”; dit unieke project is bovendien “een historisch succes”.
Het is niet ongewoon dat de vrede van na de Tweede Wereldoorlog wordt voorgesteld als het beginpunt en het morele ijkpunt van een verenigd Europa. Martin Kohli licht toe dat dit een symbolische tijdsgrens creëert die het negatieve verleden scheidt van het positieve heden, een heden waarin Europa conflicten te boven is gekomen.3 Vanuit een postkoloniaal perspectief is de representatie van Europa als bovenal een project van vrede en verzoening problematisch, legt Ghurminder Bhambra uit, omdat het historische en hedendaagse machtsverschillen tussen gebieden en tussen burgers onzichtbaar maakt.4 Kritische perspectieven als deze vragen aandacht voor de discrepanties tussen de manier waarop Europa in dominante discoursen wordt verbeeld en de manieren waarop Europa door burgers in hun dagelijkse leven wordt beleefd.
In het Huis van de Europese Geschiedenis heeft het centraal stellen van de turbulente geschiedenis van Europa in de twintigste eeuw een belangrijke narratieve functie. Bezoekers doorlopen vijf verdiepingen die zowel de ontwikkelingen richting de EU tonen, als de gruwelijkheden en de verdeeldheid die daaraan voorafgaan. De diagnose die daarop volgt, namelijk dat het momenteel “onzekere tijden [zijn] voor de Europese Unie”, laat de bezoeker slechts één keus: te bevestigen dat we voor de EU moeten vechten, zodat we niet wederom in donkere tijden vervallen. De gestelde vraag “Wat zal de toekomst zijn? Verder integreren of weer uiteenvallen?” lijkt dan ook vooral retorisch. Hans-Gert Pöttering (voormalige president van het Europees parlement en de initiatiefnemer van dit museum) liet in zijn openingsspeech geen twijfel bestaan over het gewenste antwoord: “Dit Huis moet een boodschap zijn aan iedereen dat we bij elkaar moeten blijven. Solidariteit verenigt ons in Europa”. Macron adresseert de burgers van Europa op vergelijkbare wijze in zijn brief. Ook daar is het afrondende “Het is aan u om te beslissen of…” louter retorisch, want natuurlijk betreft het hier geen keuze, maar een opdracht. En wat die opdracht is stond al eerder vermeld: “daarom stel ik u voor de verlokkingen van het ons isoleren en verdelen te weerstaan”.
Zowel in het Huis van de Europese Geschiedenis als in de brief van Macron wordt de huidige onvrede met de EU erkend en benoemd, maar uiteindelijk geïncorporeerd in een groter pro-EU verhaal. Het Huis doet een slimme zet door objecten te tonen die verwijzen naar kritiek op de EU (het Nederlandse “Nee” tegen de Europese Grondwet in 2005; het Griekse “Nee” bij het referendum over de “Griekse crisis” in 2015; het Britse “Ja” voor een Brexit in 2016), en door deze protesten tegen Europa vervolgens zelfs als een “uiting van Europeanisering” te presenteren. Het recht op kritiek is net een van de Europese verworvenheden – zo luidt de boodschap. De omstandigheden waarin de onvrede met de EU heeft kunnen ontstaan blijven onbesproken. Macrons brief draagt eenzelfde boodschap uit. Ondanks de dramatische verkondiging dat Europa “nog nooit zo in gevaar” is geweest, blijft het geloof in de “Europese beschaving die ons verbindt, ons bevrijdt en ons beschermt” en in de “vooruitgangsgedachte” pontificaal overeind, zonder dat deze kritisch wordt bevraagd.
Toch tonen zowel Macron als (de makers van) het Huis van de Europese Geschiedenis zich bewust van de veranderende plek van Europa in de wereld. Volgens Macron is de EU zelfs “de mondiale realiteit uit het oog verloren”. Wat hij hiermee bedoelt wordt niet helemaal duidelijk, maar dat het hem vooral om de grenzen van de EU te doen is wordt snel helder: “Geen enkele gemeenschap kan een gevoel van saamhorigheid scheppen, als ze haar eigen grenzen niet bewaakt. Grenzen stellen is het veiligstellen van de vrijheid.” Dit is een interessante en haast poëtische zin, omdat hij gebruik maakt van een krachtige stijlfiguur. De woorden “grenzen” en “vrijheid” vormen immers een paradox: vrijheid is onbegrensdheid, zou je denken, begrensd zijn is onvrij zijn. Uiteraard is het Macron om de vrijheid van een specifieke groep te doen: ‘wij’, de Europeanen. Om die te bewaken heeft Europa een gemeenschappelijke grenspolitie en een Europees asielagentschap nodig, want Macron gelooft in een Europa “dat zowel zijn waarden als zijn grenzen bewaakt.” Door “waarden” aan “grenzen” te koppelen wordt ook hier een onderscheid opgeroepen tussen ‘wij’ (hier binnen in Europa), die de Europese beschaving beschermen, en ‘zij’ (daar buiten Europa), die het in gevaar brengen. Als Macron vervolgens betoogt dat Europa “gericht moet zijn op Afrika, waarmee daartoe een pact dient te worden gesloten,” roept dat de vraag op of het hem daadwerkelijk gaat om de “ondersteuning van de ontwikkeling van dat continent”, of toch vooral om het bewaken van de Europese grenzen en het beschermen van de Europese beschaving. Maar wellicht maak ik me hier nu zelf ook schuldig aan een retorische vraag.
Ook in het Huis van de Europese Geschiedenis komen de grenzen van Europa aan de orde. Bezoekers krijgen informatie over de positieve gevolgen van het Schengenverdrag, dat het vrije verkeer van personen tussen de deelnemende Europese landen mogelijk maakte, en ook over de daarmee gepaard gaande strengere controles voor mensen van buiten de EU – “een gevoelige kwestie” nu Europa is “veranderd van emigratie- naar immigratiecontinent”. Verder wordt er weinig op migratie ingegaan. Wel komen de mensonterende toestanden aan de grenzen van Europa in bescheiden mate aan bod. Verschillende tentoongestelde objecten zetten aan het denken: een lijst met daarop de namen van 17306 migranten die tussen 1993 en 2012 zijn omgekomen terwijl zij Europa probeerden te bereiken, een foto van een reddingsoperatie, een zwemvest, een gevonden babyslofje, maar ook een mouwband van Frontex, het EU-agentschap dat zich toespitst op het bewaken van de Europese buitengrenzen. Maar door het bewaken van die buitengrenzen te verbinden met het wegvallen van de grenzen binnen Europa, wordt het Europese migratiebeleid gepresenteerd als de schaduwkant van een steeds meer geïntegreerd Europa. ‘We’ aanschouwen de ellende als iets dat extern aan Europa is. En dat in een museum dat zich in het hart van de Europese politiek bevindt, daar waar de verantwoordelijkheid ligt voor het huidige migratie- en vluchtelingenbeleid van de EU.
Met zijn brief waarschuwt Macron ‘ons’ voor de nationalisten die het op de EU gemunt hebben. Deze waarschuwing is niet onbelangrijk, bleek ook in Frankrijk zelf, waar Macrons pro-Europese La République En Marche! het tijdens de Europese verkiezingen moest afleggen tegen Le Pens rechts-nationalistische Rassemblement National. Maar even belangrijk is de waarschuwing van Martin Kohli voor wat hij een “Europees nationalisme” noemt, dat niet alleen tegen de buitenwereld is gericht, maar ook tegen degenen die binnen Europa de buitenwereld vertegenwoordigen. Vooral immigranten van buiten West-Europa, stelt hij, confronteren nationale bevolkingen met de vraag “of en onder welke voorwaarden ‘zij’ uiteindelijk ‘wij’ kunnen worden.” Die vraag over wie wel en niet als onderdeel van het ‘wij’ wordt gezien, dat in de retoriek van Macron en het Huis van de Europese Geschiedenis wordt aangesproken, is cruciaal als het over de toekomst van Europa gaat.
Het discours dat Macron en het Huis van de Europese Geschiedenis hanteren moet helpen voorkomen dat de Europese Unie uit elkaar valt en dat Europa, zoals Macron zegt, een “voetnoot” wordt. Maar daarbij wordt onvoldoende aandacht besteed aan het feit dat definities van Europa en ideeën over wat wel of niet Europees is continu veranderen en, niet onbelangrijk, voor een groot deel afhangen van de manier waarop een ‘niet-Europese Ander’ wordt geconceptualiseerd. Wat betekent het om een toekomstvisie voor Europa te baseren op een verhaal over een gedeelde geschiedenis of een gedeelde beschaving? Wie krijgt wel en geen plek in dat verhaal en wie wordt er wel en niet door geadresseerd? Burgers van Europa, laten ‘wij’ ons opstellen als kritische lezers van het ‘Europa’ zoals dat in politieke speeches en culturele instanties vorm krijgt.
Noten
- 1Emmanuel Macron, “Voor de Vernieuwing van Europa,” De Volkskrant, 5 maart 2019.
- 2Maria Boletsi, “Towards a Visual Middle Voice: Crisis, Dispossession, and Spectrality in Spain’s Hologram Protest,” in Komparatistik: Jahrbuch der Deutschen Gesellschaft für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft 2017 (Bielefeld: Aesthesis Verlag, 2018), 19-35.
- 3Martin Kohli, “The Battlegrounds of European Identity,” European Societies 2, no. 2 (2000): 113-37.
- 4Gurminder Bhambra, “Postcolonial Europe, or understanding Europe in times of the postcolonial,” in The Sage Handbook of European Studies, ed. Chris Rumford (London / Los Angeles: Sage Publications, 2009), 69-85.
d
clustered | unclusteredDas Ende Europas?
Thomas Lehr
Mai 2017
1. Primavera
Am vermeintlichen Ende möchte man noch einmal den Beginn an die Wand malen, in pastellenen Frühlingsfarben. Wir wollen den Geist Europas als schöne, gebildete, unschuldige Königstocher im Boticelli-Stil heraufbeschwören, selbstvergessen an der Küste des heimatlichen Phöniziens wandelnd – und scheitern doch bei jedem ihrer Schritte, traurig die zierlichen Stierhörner schüttelnd, die wir uns auf den Malerhut gesetzt haben, um ihr wenigstens als Künstler noch einmal nahe zu kommen. Die Zeit der naiven Frescen oder Mosaike für den Gebrauch in den Aulen der Tagungshotels von Brüssel bis Thessaloniki scheint endgültig vorbei. Mit unseren Stierhörnern gleichen wir ohnehin eher einem Picasso, der dem Scherbengericht der Wahrheit ins Gesicht sieht. Wenn man freundlich sein will, erblickt man anstelle der blühenden Jungfrau (wahlweise des ranken Achill) ein ziemlich ramponiertes, überaus erwachsenes Mädchen (einen vernarbten Odysseus) im blauen Sternenkostüm, das sich nach der Rauschzeit der Entführung und Verführung hart auf dem Subkontinent der Vernunft durchschlagen musste, nur noch für einige wenige Romantiker schön, aber von immer mehr Realisten als zu verlebt gemieden. Nach jahrzehntelangen Agrarstreits, nach endlosen Expeditionen im Paragrafendschungel, nach wüsten Nächten in den Bars mit Brüsseler Bürokraten, deutschen Zahlmeistern, Londoner Brexitern und ungarischen Stacheldrahttaktikern, hat es das Feiern schließlich aufgegeben, Ende der Vision. Die zertanzten Schuhe in der Hand, geht Europa wieder zur Küste und wartet auf ein Schiff, das sie zurückbringt nach Phönizien, jenem schmalem, krisenbeladenen Landstrich, den sich der Libanon, Syrien und Israel teilen, um dort heimatlos durch die Flüchtlingslager und Kriegsszenarien zu irren.
2. Minotaurus
Das wäre ein Europa, das resigniert hätte, um sich gewissermaßen selbst auszuweisen, wenigstens seinen guten Geist. Im Rücken des emigrierten Mädchens würde der Grenzzaun um die kontinentale Festung aufgelassen und durch Dutzende von nationalen Grenzmauern ersetzt, die den neuen Abwehrsperren ökonomischer und kultureller Art gleichen, wie sie sich auch um das Brexiteer-England, das Putin-Russland und das Trump-Amerika schließen. Der Stier, die dunkle schnaubende Muskelmasse des neuen Weltungeists, der Europa in den vergangenen Monaten immer entschlossener aus Europa fortzutragen oder schlicht niederzutrampeln drohte, wäre ein Konglomerat aus Nationalismus, Populismus und Protektionismus und jener Fremdenfeindlichkeit, die Frankreich den Front Nationale, Deutschland die Afd, England die Ukip, den Niederlanden die PVV, den Dänen die DF beschert hat usf. Fast scheint es, als würde ein Vierteljahrhundert nach dem Ende der bipolaren Welt des Kalten Krieges eine neue weltweite Spaltung eintreten, die den alten Kontrast und Konflikt zwischen demokratisch-kapitalistischen und staatssozialistischen Systemen ablöste durch den Antagonismus zwischen demokratischen Systemen mit noch funktionierender parlamentarischer Demokratie und autoritär-populistischen Präsidialsystemen, die sich wahrscheinlich bald nicht mehr die Mühe machten, überhaupt noch als Demokratie zu firmieren. Europa und große Teile der Welt separierten sich erneut – nicht mehr entlang der Ost-West-Achse, sondern in Form eines beweglichen Flickenteppichs, der von manipuliertem Wahlausgang zu manipuliertem Wahlausgang seine Farben wechselte. Das kühle Blau der Vernunft changierte mit dem cholerischen Rot der Wutbürger, die ihren Tyrannen begehren, der alles schlagen soll, was sie hassen und nicht verstehen. Und plötzlich sind wir froh, wenn ganz Österreich mit einem „großen“ Vorsprung von knapp vier Prozent einen rechtspopulistischen Präsidenten verhindern kann, und glücklich darüber, dass Marine Le Pen (noch) nicht Frankreich regiert. Im nächsten Augenblick wankt aber schon Italien.
3. EU-Bashing
Das letzte Mal, das die allseits beschworene Vision Europa noch zu wirken schien, war die bereits vergessene Bewältigung der internationalen Finanzkrise und die Abwendung des griechischen Staatsbankrotts. Offenkundig gehören solche Dinge zu den unerotischen Vorgängen, die wie das Ende der längst vergessenen brutalen Wirtschaftskämpfe in der Stahlindustrie, der sinnlosen Grenzgebietskonflikte oder die Etablierung der europäischen Friedensordnung keinen Eindruck auf große Teile des Wahlvolks schinden konnten. Offenbar reist auch keiner aus der nationalistisch-populistischen Fraktion, dem die Vorteile einer gemeinsamen europäischen Währung irgendwie ins Auge hätten stechen können. Wo die Infrastrukturmaßnahmen der EU zur Verbesserung der Verkehrsbedingungen, der Erhaltung und Qualifizierung landwirtschaftlicher Betriebe oder zur Durchführung lokal kaum finanzierbarer Umweltprojekte geführt haben, bleiben grundsätzlich nur die historisch längst verschimmelten Butterberge und die bauspekulativen Verschandelungen an den Küsten Spaniens in Erinnerung. Dass auch die Angler im Geiste oder rechtspopulistischen Dynamitfischer vielmehr, die vorgeben, blitzblaue Fische aus trüben braunen Gewässern holen zu können, die Vorteile des riesigen Binnenmarktes und der EU-Strukturpolitik genießen, muss ihnen in den Frühnebeln ihres Götzenkultes der starken Männer und schneidenden Frontfrauen nicht unbedingt auffallen, und mit gesamteuropäischen Bildungs- und Austauschprogrammen braucht man ihnen wohl schon gar nicht zu kommen. Nichts ist in Europa wohlfeiler zu haben als das EU-Bashing. Die Bürokraten in Brüssel sitzen in Kafkas Schloss und verkürzen seit Jahren mit undurchdringlichen Erlassen jeden Sommertag. Vielleicht liegt darin die Ursache der tiefen Frustration der Pro-Europäer: dass man mit rationalen Argumenten, ökonomischer Vernunft und historischen Belehrungen immer weiter zurückfällt hinter die Wuttiraden und schillernden medialen Inszenierungen von Vorurteilen und blankem Hass, und dass man auch diejenigen kaum mehr erreicht, die mit diffusen Ängsten und Hoffnungslosigkeit auf der so genannten Verliererseite (eine doch nachdenkenswert fatale Wortschöpfung) stehen oder zu stehen wähnen.
4. Fehlendes Forum
Wenn die EU ein großes Mangelproblem hat, dann zeigt es sich am deutlichsten in ihrer Anfälligkeit gegenüber den Agitationskampagnen und der informellen Macht ihrer Feinde. Erfolgreiche Demokratien benötigen eine lebendige politische Öffentlichkeit, in der die Auseinandersetzung über ihre Prinzipien und strittigen Details in aller Ausführlichkeit und Konsequenz geführt werden kann. Deshalb wäre erneut und dringlich darüber nachzudenken, wie man über Einzelprojekte wie den Fernsehsender Arte oder das gescheiterte Zeitungsprojekt The European hinaus ein dauerhaftes gesamteuropäisches publizistischen Forum schaffen könnte, das EU-Projekte bekannt macht, erläutert und zur Diskussion stellt. Solange es das nicht gibt, obliegt es der Verantwortung jedes Einzelnen und jedes einzelnen Mediums, europäische Belange fair und angemessen zu diskutieren. Man darf nicht müde werden aufzuzeigen – im besten, also auch kritischen Sinne aufklärerisch – was die EWG, die EG, die EU in den vergangenen Jahrzehnten bewirkt haben, anstatt nur gebannt auf den schauerlichen Tanz der Trolle und Trumpe zu starren. Wenn die Eurovision des ökonomischen, militärstrategischen und kulturellen Nutzens seltsam krampfhaft und blass wirkt, dann sollte man doch einmal tiefer hinabsteigen in die Substanz und sich fragen, was wir eigentlich meinen, wenn wir Europa sagen, es zu rühmen versuchen oder seinen Untergang befürchten. Anscheinend meinen wir nicht alles, was zur Geschichte unseres Subkontinents gehört. Weder möchten wir von der Christenverfolgung sprechen noch von den Kreuzzügen, weder von der Inquisition noch von der vernichtenden Eroberung Lateinamerikas. Wir meinen nicht die Bartholomäusnacht oder die chronisch ausbrechenden Judenpogrome, nicht den 30-jährigen Krieg, die imperialistischen Gräuel, die Weltkriege und den Holocaust. Aber aus diesen historischen Erfahrungen und im Widerspruch zu den Verheerungen und Katastrophen ist etwas hervorgegangen, haben wir etwas gelernt und entwickelt, das uns doch verteidigungswert erscheint. Unser positiver Europabegriff ist eine sehr kräftige Idealisierung von Tendenzen, Episoden und Epochen in einem Kulturraum, von dem man wohl sagen kann, dass er in den vergangenen zweitausend Jahren das Raumschiff Erde am stärksten materiell und geistig geprägt und versehrt hat, vor allem durch sein globales Ausgreifen seit dem Ende des fünfzehnten Jahrhunderts.
5. Das tiefere Bild
Wenn man versucht, das ideale Europa, das wir gerne meinen, in Schlagworte zu fassen, spürt man rasch, wie sie sich aufzulösen scheinen und sich vermehren wollen, wie sie unscharf werden und nebulös. Es ist womöglich ganz vorteilhaft, einmal die große rosa Wolke, die Europe-Cloud, die so entsteht, zu zerteilen, um zu sehen, was sie verbirgt. Den meisten werden sogleich die griechische Antike und die Demokratie einfallen, sie werden an die individuelle Freiheit denken, an die Menschenwürde und die Menschrechte. Die Rechtsordnung der Gesellschaft überhaupt kommt hinzu, ein Erbe des Imperium Romanum, aber auch die sozialstaatlichen Ideen von bürgerlicher Sicherheit und materiellem Wohlstand für alle Gemeinschaftsmitglieder, die sich stärker der christlichen Tradition verdanken. Die monotheistische christliche Religion und die parallel und im Widerspruch dazu fortentwickelte abendländische Philosophie bilden eine geistige Wirbelsäule in Form einer Doppelhelix, um die sich die Ausbildung von Gelehrsamkeit, Wissenschaft und Bildung zur anatomischen Grundlage der Gesellschaft formten (auch wenn das alles mit dem aktuellen Fernsehprogramm und dem Umgangston von öffentlichen Debatten nicht sonderlich viel zu tun zu haben scheint). Mit der Forcierung von Naturwissenschaft und Technik hat Europa die Grundlage der modernen Welt geschaffen und über die sich neu gestaltende Gesellschaft im Humanismus und in der Aufklärung nachgedacht bis zur Formulierung der Freiheits-, Gleichheits- und Brüderlichkeitsideale der Französischen Revolution. Durch das europäische Bürgertum wurden individuelle Kunst, individuelle Kultur und Lebensweise etabliert, Europa hat den Kapitalismus erfunden und seine kommunistische Nemesis, die einmal die Welt spalteten, aber auch den Liberalismus und die Idee einer sowohl freien als auch geregelten, gesellschaftlich kontrollierten Ökonomie. Dass wir heute recht viel meinen, wenn wir nur Demokratie sagen, dass wir nicht nur von allgemeinen, gleichen und freien Wahlen sprechen, sondern auch von der Gewaltenteilung in einer rechtstaatlich organisierten, sozialstaatlich engagierten, vom Souverän des Volkes her legitimierten Gesellschaft, verdankt sich vor allem den europäischen Auseinandersetzungen, Kämpfen, Debatten und konstitutionellen Festlegungen der vergangen fünf Jahrhunderte (forciert, beschleunigt und konsolidiert durch die Paralleldemokratie der immer mächtiger werdenden USA). Nach wie vor prägen Kunst und Kultur und auch die institutionalisierte, staatstragende Religionspraxis des Christentums, die in Europa entstanden ist, die Welt. Vor allem aber wirken in ihr die in Europa entstandenen Sprachen, die von drei Milliarden Menschen, etwa vierzig Prozent der Menschheit gesprochen werden. Die europäische Literatur, die in ihnen geschrieben wurde, von Homer bis Ovid, von Gottfried von Straßburg bis Cervantes, von Dante bis Shakespeare, von Molière und Racine bis zu Goethe, Tolstoi und Joyce bildet den wohl wichtigsten Stamm der Weltliteratur aus.
6. Globalisierung der Globalisierten
Der Blick in diese rosa Riesenwolke, die den Globus umhüllt, ist immerhin tröstlich: Man sollte ihn sich für einige Zeit gönnen, bevor man anfängt, das Zeus’sche Gespinst analytisch weiter aufzulösen. Dass etwas in Europa entstanden ist, bedeutet nicht, es sei auch dort geblieben oder dort am besten verwahrt worden. Nordamerika, als einstiger Traum europäischer Flüchtlinge und Auswanderer, ist schon seit Beginn des 20. Jahrhunderts die militärisch und wirtschaftlich stärkste Macht und übte spätestens seit 1945 den stärksten kulturellen Einfluss im globalen Maßstab aus. Nach wie vor sind die USA die erfolgreichste Demokratie, auch wenn sie sich nun jeden Tag von einem unwürdigen und gefährlichen Präsidenten beleidigen lässt und bei einer ihrer schwierigsten Bewährungsproben angelangt scheint. Das Englisch, Spanisch und Portugiesisch sprechende Lateinamerika verfolgt seit Jahrzehnten seine eigene Entwicklung, für die es Europa nicht braucht. Die größte Demokratie der Welt ist Indien, und weitere Demokratien gibt es in Israel, Japan, Südkorea oder auch in Afrika, wo einige Länder, akkurat mit dem Bertelsmann Transformation Index gemessen, so allmählich bessere Demokratiewerte aufzuweisen beginnen als gewisse Staaten an den Rändern der EU. So gesehen, erweist sich die Rede vom Ende Europas als nahezu so unsinnig wie das Ende der Atemluft, auch wenn diese verschmutzt werden kann oder knapp. Die stärksten Werte, Ideen, kulturellen, sozialen und ökonomischen Innovationen, die Europa entwickelt hat, sind schon so weit über den Globus verbreitet und so tief in das internationale gesellschaftliche Genom (als Kanon westlicher Werte) eingeschrieben, dass Europa auch dann erhalten bliebe, wenn sein Ursprungskern weitgehend zerfiele. Selbst das komplette Auseinanderbrechen der EU würde das europäische Projekt nicht beenden. Es hat sich mit seiner ab der Neuzeit stark aufgefüllten Schatzkiste, in der man die Aufklärung, den Humanismus, die fortentwickelte Gesellschaftstheorie und -praxis, die moderne Wissenschaft, Philosophie, Literatur und Kunst auffinden kann, an die Menschheit vererbt so wie es selbst der Erbe der in ihm aufgegangen antiken Welt und der altorientalischen Kulturen gewesen ist.
7. Das Grand Design
Indes ist der totale politische Zerfall kaum zu befürchten. Es war schließlich die außerordentliche Anziehungskraft, die wirtschaftliche, kulturelle und sozialpolitische Attraktivität der EU, die zu einer Großgemeinschaft von achtundzwanzig Staaten führte, und es ist nicht anzunehmen, dass der Brexit eine rasche Kettenreaktion von Austritten verursacht, selbst wenn dieser Teufel gern an die Wand gemalt wird. Nach wir vor besitzt die Mehrheit der EU-Staaten rational handelnde Regierungen. Anzunehmen, dass eine nach der anderen ins nationalistische und populistische Fahrwasser abgleitet, entbehrt jeder Grundlage, was auch immer die Kommentatoren schreiben mögen. Auch wenn die EU drei oder fünf Staaten verlöre oder die Gemeinschaft auf den Stand von 1995 mit fünfzehn Mitgliedern zurückfiele, wäre sie ein enormer Wirtschaftsraum und ein bedeutsamer politischer Machtfaktor. Es ist offenkundig, dass ein Block von weitgehend harmonisierten Mitgliedsstaaten, die geografisch zusammenhängen, eine gemeinsame Währung besitzen und es womöglich noch zu einer gemeinsamen Armee bringen (müssen), nach außen hin die stärkste Wirkung hat. Indessen scheint es fraglich, ob die schiere Größe und Anzahl so wichtig ist. Wenn die in der EU verbleibenden Staaten weiterhin ihre vier- und vierteljährlichen Krisen meistern und eine solide und verantwortliche Politik finden, dann kann es durchaus zur Rückkehr von ehemaligen Gemeinschaftsmitgliedern kommen. Auch wenn es unpopulär klingt: Politik bleibt das Bohren harter Briter und Bretter, und bei aller Euroskepsis (jene überkommene, altersmilde Form der rezenten Hasskultur) sollte man den eigentlichen Masterplan, das humane europäische Grand Design, doch nicht vergessen. Der wichtigste Grund für das politische Zusammengehen der europäischen Nationen, das bislang in der EU und der Euro-Zone gipfelte, war ein politischer Grund – against all odds. Nach zwei Weltkriegen mit fast siebzig Millionen Todesopfern ging es in erster Linie um die Errichtung eines dauerhaften Friedenszustandes in Europa, um die Unausdenklichkeit eines erneuten Waffengangs zwischen den großen europäischen Mächten, indem man die wirtschaftlichen, militärischen und kulturellen Konflikte durch einen dauerhaften Verbund und die institutionalisierte Freundschaft möglichst sämtlicher europäischer Nationen beseitigte. Dieses Grand Design ist tatsächlich seit über sechzig Jahren Realität. Das ist für Zeitgenossen beeindruckend – aber für den historischen Weitblick keineswegs zureichend angesichts der vorausgegangenen zweitausend Jahre, in denen ein Krieg in Europa den anderen ablöste. Die unabdingbare Voraussetzung für die haltbare Völkerfreundschaft, jenseits des Euro und des gemeinsamen Marktes, sind friedfertige, nicht-nationalistische Einzeldemokratien. Mit ihrem immer noch schwachen Parlament, der Dominanz des Europäischen Rats und der Kommission, ist die EU noch lange kein demokratischer Bundesstaat, sondern ein Staatenverbund mit semi-demokratischen inneren Strukturen, dessen demokratische Legitimität am stärksten auf der Legitimität der einzelnen, in den Nationalstaaten gewählten Regierungen beruht. Fatal wäre daher die zersetzende Aufweichung der demokratischen Standards und der humanen Politik, die aus der EU eine unkenntliche und unappetitliche Staatenmasse machen würde. Um es provokant zu formulieren: Trotz der ähnlich bedauerlichen Migrationspolitik muss einem ein Brexit-England, das seine innere demokratischen Würde behält, lieber sein als ein EU-Ungarn, das mit der demokratischen Substanz der EU Schindluder zu treiben beginnt, oder ein EU-Polen, das die Form eines Einparteienstaates anzunehmen droht. In diesem Sinn sollte man vielleicht sagen, dass Europa, der gute Geist Europas, tatsächlich wichtiger ist als die EU. Die kleinen osteuropäischen Länder, die auf ihr energisches Drängen hin im Verlauf der vergangenen zwölf Jahre Aufnahme in der EU fanden, verdienen sicher Verständnis für ihre schwierige Situation. Sie, die historischen Bloodlands, die von der Geschichte, vor allem unter Deutschland und Russland, am Schlimmsten verheert wurden, haben einen komplizierten, opferreichen Transformationsprozess hinter sich und bilden doch noch immer die ökonomischen Schlusslichter der EU. Dennoch darf die Gemeinschaft eine chauvinistische und autoritäre Verformung von Mitgliedsstaaten nicht hinnehmen. Brächte man das Selbstbewusstsein auf, dem ein oder anderen Staat klar die Tür zu weisen, wenn er dauerhaft die EU-Normen untergräbt, dann wäre das Spiel mit dem Exit höchstwahrscheinlich viel weniger reizvoll.
8. Utopisches Europa?
Solange die Abstriche, die man vom kaum erreichbaren und vielleicht auch nicht um jeden Preise wünschenswerten Ideal einer Gemeinschaft von achtundzwanzig Staaten mit gleicher Währung, gleicher Wirtschafts- und Sozialpolitik, gleicher Bildungs- und Migrationspolitik machen muss, nicht die demokratische Substanz der EU betreffen und nicht zu einem Austritt en masse führen, wird die EU ein differenzierter und attraktiver Wirtschafts- und Gesellschaftsraum bleiben, mit einer ökonomischen Potenz, die der Wirtschaftskraft Chinas oder der USA gleichkommt. Nach wie vor ist die EU der größte Binnenmarkt der Welt. Nach wie vor übertrifft ihr Bruttoinlandsprodukt das der USA. Nach wie vor besitzt die EU die beste Infrastruktur der modernen Industriestaaten. Von daher gibt es wenig gute Gründe für den Katzenjammer, der aus jeder Krise eine Götterdämmerung macht und aus dem britischen Exit sogleich den Anfang einer Austrittslawine. Es wird im Laufe der kommenden Jahrzehnte vermutlich noch einige Aus- und Wiedereintritte geben, über die Papiergräben beschworener Untergänge hinweg. Immer noch ist das EU-Projekt historisch jung, das Euro-Projekt erst recht. Dass Europa schon lange nicht mehr das große leuchtende Ziel darstellt, ein Menschheitsutopia, nach dem jeder sich sehnt, liegt wie bereits gesagt auch mit an seinem weltweiten historischen Erfolg. Die USA, Lateinamerika, Indien, Japan und weitere Länder in Asien oder Afrika sind längst Teil des demokratischen Großprojekts, das dadurch diversifiziert, mächtiger und chancenreicher wurde. Um noch einmal eine provokante Formulierung zu gebrauchen, könnte man in diesem Zusammenhang feststellen, dass das Verhalten von einer Milliarde Indern wichtiger ist als das von zehn Millionen Ungarn. Im Zeitalter der Globalisierung ist Europa nur noch Teil der Lösung, die bei aller kulturellen Differenz die sichere und würdige, den Menschenrechten gemäße Lebensform für jeden einzelnen ermöglichen sollte und bezüglich der internationalen Konfliktgestaltung immer noch hinstreben muss zur Utopie des Kant’schen Ewigen Friedens, über den jämmerlichen Zustand einer von jeder Großdiktatur jederzeit blockierbaren UN hinaus.
9. Vier Hauptprobleme
Wenn man sich fragt, welches die großen inneren Probleme sind, die zur Depression des Europagedankens und zum Auftrumpfen des Populismus geführt haben, dann sieht man unweigerlich vier Felder. Anfangen sollte man wohl am besten mit dem hausgemachten Problem, der familiären Angelegenheit, die sich naturgemäß um die Kontrolle der Macht dreht. Nach wie vor ist der Rat der Regierungschefs der handelnde Souverän der EU, der in seinen Entscheidungen nicht substantiell vom EU-Parlament abhängt. In Krisenzeiten tritt das besonders scharf hervor, ebenso wie durch die mittlerweile äußerst wichtige Rolle der Europäischen Zentralbank der Eindruck verstärkt wird, Chefs und Bosse würden hinter verschlossenen Türen sämtliche wichtige Entscheidungen ohne wirkungsvolle Kontrolle treffen. Wäre die gemeinsame politische Öffentlichkeit weiter entwickelt, verfügte das Europäische Parlament über mehr Einfluss und rückte mehr in den Fokus der allgemeinen Aufmerksamkeit, etwa indem es wenigstens mit jeder zweiten Europawahl in eine andere Landeshauptstadt wechselte, statt in Straßburg zu verharren wie „die in Brüssel“, dann nähme das allgemein verbreitete Ohnmachts- und Bevormundungsgefühls wohl ab. Die Voraussetzung für die Intensivierung der supranationalen Demokratie ist natürlich die weite Zustimmung zu einer solchen verstärkten europäischen Integration. Eben das, die Prinzipien und längerfristigen Ziele der EU, sollten erneut und ständig in den öffentlichen Diskurs rücken, jenseits von Integrationsautomatismen und vermeinten schicksalsgemeinschaftlichen Alternativlosigkeiten. Das Quo vadis mitbestimmen, mitverfolgen und mitverantworten zu können, ist für die Akzeptanz der EU in der breiten Bevölkerung ausschlaggebend. Aber auch wenn die Gemeinschaft sich vollkommen darüber im Klaren wäre, ob sie sich in Richtung eines supranationalen Bundesstaats oder eines dauerhaften Staatenverbunds mit festgelegten Autonomiegebieten bewegen wollte, stellten die drei anderen, aktuellen Problemfelder große Herausforderungen dar. Das weiteste und schlimmste Feld ist die sozialökonomische und kulturelle Zerteilung der modernen Gesellschaften. Sie hat soweit geführt, dass man nicht mehr von der Zweidrittel-Gesellschaft, sondern mehr wohl schon von einer halbierten Gesellschaft sprechen könnte, ganz so, wie es das Brexit-Votum oder die amerikanischen und die österreichischen Präsidentenwahlen mit knappsten Ergebnissen an der Fünfzig-Prozentgrenze der Wahlbeteiligten nahe legen. Eine chronische Schizophrenie, die ein populistisch angeführtes von einem noch von demokratischen Parteien geleitetes politisches Lager fortwährend an der Fünfzig-Prozent-Frontlinie einander gegenüberstellen würde, wäre denkbar gefährlich. Sie würde mit ihrer Aufkündigung des gesellschaftlichen Konsenses die Demokratie bei jeder Wahl radikal in Frage stellen. Die Stabilität von Demokratien beruht letztlich darauf, dass – wie unterschiedlich auch immer die Parteiprogramme sich präsentieren mögen – entschieden mehr als die Hälfte der Wähler, am besten mehr als achtzig Prozent, sich zur Demokratie bekennen und auch Wahlentscheidungen zugunsten ihrer Gegner im demokratischen Rahmen annehmen können. Wenn auch aus ganz anderen historischen Gründen, so haben wir doch eben diese Situation von unversöhnlich gespaltenen Gesellschaften, deren radikal unterschiedliche Politikvorstellungen den Konsens und das friedliche Zusammenleben zerstören, direkt vor Augen. Sie verursacht den permanenten inneren Unfrieden der arabischen Welt. Und es ist die politische Entwicklungskatastrophe der arabischen Länder, welche die beiden anderen akuten Problembereiche der westlich orientierten Demokratien mit hervorruft: den Immigrationsdruck und die Nemesis des islamistischen Terrorismus. Auf der Grundlage der vorhandenen gesellschaftlichen Ungleichheit wirken sie wie Katalysatoren für die sozioökomische Zerklüftung.
10. Ungleichheit als Sprengkeil
Wie gesagt sind die historischen Ursachen für die schizophrene Schwankung der arabischen Länder zwischen theokratischem Mittelalter und gesellschaftlicher Moderne anderer Natur als die im Wesentlichen ökonomisch hervorgerufene drohende Zweiteilung der demokratischen Nationen des Westens. Hier wie dort sind die Lager auch alles andere als eindeutig und stabil. In zahlreichen westlichen Ländern tritt noch keinesfalls eine Spaltung zwischen populistisch Verführten und Anhängern tradierter Programmparteien an der Fünfzigprozentgrenze auf. Gerade Deutschland darf einmal, begünstigt durch die gute ökonomische Situation, zu der die EU und der Euro vieles beigetragen haben, als Hort der politischen Vernunft gelten. Aber populistische Erfolge an der Zwanzigprozentgrenze sind ein Grund für die Alarmstufe Rot (oder vielmehr Blau). Dabei haben wir es ja bei den Populisten gar nicht mit Anti-Europäern zu tun, sondern mit Hyper-Europäern, die ihren Anhängern vorgaukeln, ihr blaues Gebräu aus Xenophobie, Rassismus und demagogischen Heilsversprechen wäre der olympische Nektar. Bevor man nun die Einzelheiten der Immigrations- oder Asylpolitik mit ihnen diskutiert (und man wird nicht umhin können, das immer wieder ausführlich und entschieden zu tun), sollte das Augenmerk sich aber auf die doppelte Grundlage der Verführbarkeit zu radikal-populistischen Phrasen richten. Das eine Moment der Vernebelung ist schlicht politisch-medial. Es beruht auf der Aufpeitschung von akuten Stimmungslagen durch die Manipulation von Öffentlichkeit, sei es durch Brandreden auf Marktplätzen, Facebook-Kampagnen oder Hasskommentare in den einschlägigen dreinschlagenden Postillen. Hier kann die Antwort wieder nur kulturell und medial sein, indem man eben den Streit aufnimmt, kritische Zustände vor allem der sozialen Medien moniert und in den Medien dagegenhält. Die zweite Ursache der Manipulierbarkeit liegt tiefer. Sie verweist auf das geborstene oder doch vielmehr zu bersten drohende Fundament der solidarischen Gesellschaft, die drastische Ungleichheit, wie sie zum Beispiel Thomas Pickety empirisch fundiert angeprangert hat. Wenn man zurückdenkt an die zutiefst prägenden Ideale des europäischen Wertekanons, dann stehen angesichts der sich zerklüftenden Gesellschaft nicht nur sozialstaatliche oder sozialdemokratische Vorstellungen in Frage, sondern auch die allgemeineren Vorläuferideale der Französischen Revolution von Brüderlichkeit und Gleichheit und letztlich auch die christlichen Gebote von Barmherzigkeit und Nächstenliebe. Keiner wird die europäische Idee in Europa bewahren können, der nicht eine dauerhafte politische Lösung des sozialen Ausgleichs und der gesellschaftlichen Teilhabe findet.
11. Die Schutzhülle
Das Thema Immigration und Asyl, das gegenwärtig den Populisten einen starken Auftrieb verschafft, enthielte viel weniger Explosivstoff, wenn es einen ausgewiesenen, deutlich und dauerhaft verkündeten Konsens zur gesellschaftlichen Grundsicherung gäbe. Was spricht eigentlich dagegen, dass man es anstrebt jedem Bürger unserer reichen demokratischen Gesellschaften das lang reklamierte Recht auf Arbeit, Wohnung, Gesundheitsfürsorge, genügend Altersversorgung und ausreichendes Grundeinkommen zuzusichern, wenigstens als konkretes politisches Ziel – und zwar EU-weit? Die gegenwärtigen Sozialsysteme nähern sich doch gewissermaßen unausgesprochen diesem Ideal. Würde man es politisch forcieren und deutlich verfolgen, so dass die Bürger den zuverlässigen Eindruck erhielten, man bemühte sich ernsthaft um die Erschaffung einer Art stabiler sozialer Schutzhülle, einer materiellen und sozialen Grundsphäre, auf die sie ein Anrecht hätten und die ihnen niemand nehmen könne, dann hätten es die Angstmacher jeglicher Couleur sehr schwer. Ich weiß, dass ein solcher Sicherheitskokon an das realsozialistische Alltags-Versprechen erinnert – indes sollte man doch gründlich darüber nachdenken, ob es nicht auch mit einer freien Gesellschaft vereinbar wäre. Die leidige Asyl- und Immigrationsdebatte wäre dann von der jederzeit zum Hass schürbaren existenziellen Unsicherheit befreit und könnte sich rational mit den beiden Grundproblemen der Aufnahme von Ausländern befassen: Wie viele Menschen aus anderen Ländern kann das eigene Land aufnehmen, und wie lassen sie sich so integrieren, dass sie von den Einheimischen nicht nur hingenommen, sondern auch wohlwollend als gute Mitbürger begrüßt werden?
12. Immigration und Asyl
Zu dem quantitativen Problem der Einwanderung sollte doch eigentlich ein Konsens möglich sein: Immigration kann man beschränken – Asyl nicht. Jedes Land, das Einwanderer aufnimmt, hat das Recht, die Zahl der Einwanderer und die Voraussetzungen für die Aufnahme und das Dableiben zu definieren. Gerade deswegen wäre die klare Selbstbestimmung Deutschlands als Einwanderungsland „hilfreich“, um es mit der Bundeskanzlerin zu sagen. Und selbstredend wird man in einer Demokratie über die Details und die Grenzen streiten dürfen. Asyl dagegen sollte jeder humane Staat grenzenlos gewähren. Es ist ein temporärer Schutz, ein elementarer Akt der Menschlichkeit, christlich, europäisch, universell, über den es prinzipiell keine Diskussion geben müsste. Das Schreckgespenst von der unendlichen Flut von Asylbewerbern entbehrt der historischen Grundlage, daran ändert auch das Jahr 2016 nichts, und wir sollten klar festschreiben, dass Staaten, die sich der gemeinschaftlichen Asylgewährung verweigern, nicht Mitglied der Europäischen Union sein können. Es ist eine ganz andere Frage, wie das Asyl gestaltet wird und was man von den Flüchtenden erwarten kann. Selbstverständlich darf ein Asylbewerber nicht kriminell oder terroristisch werden, selbstverständlich muss er sich an die wichtigsten allgemeinen Regeln im Alltagsleben der modernen demokratischen Gesellschaften halten, wenn er nicht permanent Ärger haben möchte – und selbstverständlich haben wir das Recht, unsere so genannte Identität, das heißt zumeist die uns lieb gewordenen Sitten und Gebräuche, zu wahren. In Deutschland tanzt im Rheinland beim Karneval der Bär und Tausende von Frauen ziehen nachts in freizügigen Kostümen durch Köln, Bonn und andere Städte. Wer sie beleidigt oder anfasst, macht sich strafbar und sollte auch sehr rasch und empfindlich bestraft werden. Wenn man die Fakten sieht, dann weiß man, dass die meisten Menschen, die in den europäischen Ländern Asyl genießen, nicht kriminell werden und dass sich auch im Durchschnitt die Kriminalität von Menschen im Asylstatus nicht sonderlich vom Bevölkerungsmittel unterscheidet. Dennoch macht es keinen Sinn, die Augen vor akuten Brennpunkten zu verschließen. Wenn Dörfer in der Provinz mehr Asylbewerber verkraften sollen, als sie Einwohner haben, wenn Stadtviertel Gettocharakter annehmen, wenn der Großteil der Flüchtlinge aus Nordafrika aus jungen Männern besteht, dann helfen abstrakte Prinzipien allein nicht weiter, sondern nur eine offensive Politik. Das Einsickern von Terroristen in die Flüchtlingsströme ist ebenso eine reale Gefahr – aber eine, der man nicht mit dem Asylrecht, sondern mit polizeilichen Maßnahmen beikommen muss. Man kann durchaus für eine tolerante Asylpolitik sein und zugleich wirksame Maßnahmen gegen den islamistischen Terrorismus befürworten, der ein gnadenloser und verachtenswert jämmerlicher, blindwütig wehrlose Zivilisten attackierender Feind ist.
13. Der islamische Nachbar
Dass man bei der Betrachtung der europäischen Angelegenheiten so viel über den in Europa doch minoritären Islam reden muss, hängt mit der unlösbar scheinenden, jahrzehntelang währenden Krise der arabischen Welt von Kairo bis Bagdad zusammen und mit der unumstößlichen Tatsache, dass die arabische Welt bzw. der Vordere Orient nun einmal die unmittelbare Nachbarschaft Europas darstellen. Seit vielen Jahrhunderten sind die Geschicke der Regionen miteinander verknüpft, und man muss sagen, oft im negativen Sinne für beide Seiten, angefangen bei der Entfaltung und Expansion des Islam, die von der zielgerichteten Etablierung in Jerusalem und der Besetzung Südspaniens bis zur der versuchten Eroberung Wiens reichte, und umgekehrt von den Kreuzzügen bis zur europäischen Kolonialpolitik des neunzehnten und zwanzigsten Jahrhunderts. Wenn wir heute von einer krisengeschüttelten, von Bürgerkriegen und Nachbarkriegen versehrten nahöstlichen Region sprechen, die uns beunruhigt, mit Flüchtlingswellen konfrontiert und mit Terroranschlägen quält, so war Europa – und das insbesondere von Deutschland ausgehend – umgekehrt für viele Jahrzehnte eine notorisch zerstrittene, aggressive Region, die die ganze Welt mit Krieg überzog. Und auch nach 1945 haben Europa und die USA in der islamischen Welt große Verwerfungen ausgelöst, sei es mit ihrer entschiedenen Unterstützung Israels (die ich mir manchmal kritischer wünschte, aber die ich prinzipiell unterstütze, so dass ich eben wie mein Land zu einer Partei im Nahen Osten gehöre), sei es durch die Zusammenarbeit mit fragwürdigen Regimen wie dem des persischen Schahs oder dem Saudi-Arabiens bis hin zu den verhängnisvollen Kriegen gegen den Irak. Dagegen stand und steht der produktive, neugierige, humane Austausch auf den Gebieten von Literatur und Kunst, Architektur und Film. Der Handel, der Wissenschafts- und Techniktransfer, der Tourismus, die Entwicklungsprojekte, die Umweltinitiativen in den vergangenen Jahrzehnten, das Ölgeschäft in seinen vielfältigen (nicht nur negativen) Facetten, die gemeinsamen Industrieprojekte sind Ausdruck für eine immer tiefer greifende Nachbarschaft und für ein Miteinander, das schon längst auf der materiellen Basis das Goethe-Wort von der Untrennbarkeit des Orients vom Okzident verwirklicht hat. Die Krisen, in der sich die arabischen Staaten befinden, werden Europa immer weiter betreffen. Allein schon aus diesem Grund sollte Europa sich nicht bloß belästigt oder von Terroristen heimgesucht fühlen, sondern versuchen, den gesamten Nahen Osten als Entwicklungsregion und enge Nachbarschaft zu begreifen, die auf eine jahrhundertelange künftige Zusammenarbeit angelegt ist – endlich auf kooperativer Basis und mit dem festen Vorsatz, die zivilisatorischen Gemeinsamkeiten weiter zu entwickeln, die jedem ins Auge springen, der wenigstens ein oder zwei moderne arabische Länder besucht oder einige Romane von modernen arabischen Autoren gelesen hat. Auch die Geißel des islamistischen Terrorismus kann nur so beseitigt werden. Die Ereignisse in Madrid, Paris, Nizza, Brüssel und nun auch in Berlin dürfen uns nicht vergessen lassen, dass nach wie vor die islamische Welt, von Kabul bis Bagdad, von Mossul bis Kairo ungleich stärker unter dem islamistischen Terror zu leiden hat als der Westen. Nur in der Zusammenarbeit mit den islamischen Ländern, mit den Regierungen in Afghanistan, Pakistan und den Staaten der arabischen Welt ist es möglich, den islamistischen Terrorismus zu besiegen, nur in Kooperation mit den aufgeklärten demokratischen Kräften der Region und mit dem dialogbereiten, moderaten Islam. In einem erweiterten, menschheitsgeschichtlichen Sinn gehört der Islam ja tatsächlich zu Europa, denn gemeinsam mit dem Christentum und dem Judentum ruht er auf der zivilisatorischen Basis der altorientalischen Reiche. Im Bagdad des 9. Jahrhunderts rettete die islamisch-arabische Hochkultur unter den abbasidischen Kalifen den antiken Kulturschatz und erweiterte ihn in der Folge um zahlreiche mathematische, naturwissenschaftliche, medizinische Innovationen, die sie – ganz abgesehen von ihren literarischen und künstlerischen Schätzen – an das wieder neu entstehende mittelalterliche Europa weiterreichte. In der gemeinsamen Wurzel und im Eingedenken an die Phasen des produktiven Austauschs liegt die Zukunft eines weltoffenen Europas. Europa ist ohne die lebendige Nachbarschaft mit der benachbarten Islamischen Welt nur als ewige Kreuzritterburg auf eigenem Boden denkbar. Weshalb gründen wir nicht eine Kette von Thinks Tanks entlang der Mittelmeerküste, um gemeinsam voranzukommen? Es gibt einen Defätismus in Europa, der aus Aufgaben Katastrophen macht. Ihn gilt es zu überwinden, gerade für Konsumgesellschaften, die immer wieder unter ihrer vermeintlichen Sinnleere ächzen und vorgeben, nach konkreten, verwirklichbaren Utopien zu suchen. Und was für die Entwicklung der Nachbarschaft und die Bekämpfung des Terrorismus gilt, gilt schon längst für die friedliche Immigration. Abgesehen davon, dass die Mehrheit der Immigrationswilligen nicht aus knochenkonservativen Muslimen (sondern auch aus Christen, Agnostikern, Papier-Muslimen etc..) besteht, lässt sich die Immigration aus dem Nahen Osten und den afrikanischen Ländern am besten mit einer bewussten und durchdachten Einwanderungspolitik steuern. Wenn wir eine Gesellschaft mit einer zupackenden, fördernden, vielfältigen Immigrationspolitik sind, werden wir ökonomisch erfolgreicher sein - und noch dazu kulturell vielfältig und bedeutender.
14. Die russische Karte
Das Nachdenken über Europa muss sich in der heutigen Zeit so intensiv mit dem Nahen Osten beschäftigen, weil die dortigen Kriege und Bürgerkriege mit den Flüchtlingskatastrophen, die sie verursachen, und dem Terrorismus, den sie exportieren, von den hiesigen populistischen Parteien als Spaltkeile im Fundament der demokratischen Gemeinschaft angesetzt werden. Zu den aufspaltenden Momenten gehört – nach der Euphorie der neunziger Jahre – das infolge des Ukraine-Konflikts und des Kriegs in Syrien schwer beschädigte Verhältnis zu Russland. Im Augenblick ist kaum vorstellbar, dass es bald wieder besser werden könnte, aber zwei Aspekte könnten doch eine gewisse Hoffnung nähren. Zum einen ist Russland ein Teil Europas, wenigstens bis zum Moskauer Längengrad zutiefst mit der europäischen politischen und kulturellen Geschichte verflochten. Man kann sich nicht vorstellen, dass die Bürger Russlands diese Zugehörigkeit auf Dauer verleugnen oder verleugnet sehen möchten. Zum anderen steht die Großmachtpolitik des Vladimir Putin auf tönernen ökonomischen Füßen. Russland kann seine Rohstoffe nicht essen und mit Computerviren und Atombomben lässt sich nur sehr bedingt politischer Einfluss sichern. Das russische Bruttoinlandsprodukt ist etwas größer als das Spaniens, das deutsche ist zweieinhalb mal so hoch, das der EU mehr als dreizehn mal. Gewiss gibt es noch andere Indikatoren für ökonomische und politische Macht – aber man sieht die engen Grenzen, die der russischen Autokratie gesteckt sind, und man kann damit rechnen, dass sie sich auswirken werden. Pessimisten werden jetzt wahrscheinlich noch den Teufel eines neuen USA-GUS-Blocks unter Trumputin an die Wand malen – aber bis die Wasser der Wolga in den Mississippi fließen, scheint es doch noch lange hin. Allein zehn oder fünfzehn EU-Staaten, zu denen vielleicht doch dauerhaft Deutschland, Frankreich und Italien gehören, stellen eine enorme Wirtschaftsmacht dar, die ihren Einfluss geltend machen kann.
15. Supermacht – so what?
Dennoch kann es sein, dass die EU scheitert – zumindest als Bund von achtundzwanzig oder auch fünfundzwanzig Staaten, die jene harmonisierte gemeinsame Wirtschaftspolitik, Asyl- und Einwanderungspolitik, Außenpolitik und Rüstungspolitik betreiben, die man sich wünscht und die ein Maximum an Stärke mit sich bringen würde. Manchen frustriert die mangelnde militärische Potenz der EU ganz besonders. Aus historischen Gründen, bei Berücksichtigung der kulturellen und sprachlichen Unterschiede, kann man sich in der Tat kaum eine einheitliche und schlagkräftige EU-Armee in der nächsten Zukunft vorstellen, die der wirtschaftlichen Bedeutung der Gemeinschaft entspräche und es ihr erlaubte, neben den USA, Russland und China als führende Militärmacht aufzutreten. Die Frage ist allerdings, ob das eine solch bedeutende Rolle spielt und ob sich mit der EU als Militär-Supermacht die globalen Dinge zum Besseren wenden würden. Wenn statt dessen die EU eine Art globaler Schweiz vorstellte, eine Insel der weltoffenen erfolgreichen Demokratie, die zwar nicht den militärischen Global Player spielen, aber sich selbst verteidigen und ihre wohlfahrtsstaatlichen Standards wahren kann, dann könnte man sich doch durchaus als Bürger darin wohl fühlen. Und sind wir denn tatsächlich so verzweifelt weit davon entfernt, wie manche Kommentatoren es glauben machen? Die ökonomische Krise in einigen EU-Staaten ist bedrohlich. Aber sie kann im Rahmen der Gemeinschaft wesentlich besser gelöst werden als von einzelnen sich abschottenden Nationalstaaten – mag dies auch nur ein Glaube an die volkswirtschaftliche Vernunft sein. Die erreichten Fortschritte im Umgang der europäischen Länder untereinander können aber auch Kritiker kaum bezweifeln. Wenn man sich anschaut, mit welcher Angst, Hysterie, Desinformiertheit und Aggressivität sich die europäischen Nationen vor hundert Jahren, kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs begegneten, kann man über den gegenwärtigen Austausch und die gegenwärtigen diplomatischen Prozeduren und Institutionen nur froh sein. Deshalb sind Déjà-vu-Vergleiche zu 1914, die manche Historiker anstellen, recht fragwürdig. Sie beruhen auf einer Geringschätzung der Qualität der gegenwärtigen Diplomatie – bei allem Verständnis dafür, vor den Willkürakten der „starken Männer“ zu warnen, die gewiss eine große Gefahr darstellen.
16. Primavera II
Bei nüchterner und realistischer Betrachtung scheint mir die EU um einiges besser und stärker zu sein, als es viele Kassandrarufe befürchten lassen. Sie hat sich, ihre Vorläuferorganisationen mitgerechnet, über Jahrzehnte gehalten, sie hat etliche Krisen überstanden und bietet zu viele offensichtliche Vorteile, als dass sich in der nächsten Zeit der Großteil ihrer Mitglieder dem erschreckenden Beispiel der Briten anschließen wollten. Sechzig Jahre Frieden in Europa, intensiver ökonomischer und kultureller Austausch mit den Höhepunkten der Schaffung einer gemeinsamen Währung und des freien Reiseverkehrs auf der Basis des – gewiss nicht auf ewig bedrohten – Schengener Abkommens haben eine gelebte, faktische Nähe und ein Zusammengehörigkeitsgefühl geschaffen, das niemand unterschätzen kann, der sich schon einmal in London, Dublin, Paris, Wien, Madrid, Berlin, Kopenhagen, Stockholm oder Amsterdam als Europäer mit Europäern unterhalten hat. Europa als Vorbild für andere Weltregionen, als Vision oder als Utopie ist freilich am Ende und dahin, nicht weil der Brexit erfolgte oder populistische Bewegungen es unsicher machten, sondern weil es inzwischen längst um mehr geht als um Europa, nämlich um das friedliche Zusammenleben und das Überleben der Menschheit. Ein Gutteil der in Europa entstandenen Wertvorstellungen und politischen Organisationsformen gehört zum kosmopolitischen Gemeingut. Das ist ein Erfolg, der es dem alten Kontinent ermöglichen sollte, sich noch besser auf seine demokratischen und humanistischen Grundlagen zu besinnen. Europa kann und braucht auch nicht mehr zu führen. Ein sich neu erfindendes Europa mit weniger narzisstischer Prägung, mit stärkerer demokratischer und sozialstaatlicher Teilhabe und mehr Odysseusschem Mut, das sich als eines der aktiven Zentren für die universellen Entwicklungsaufgaben verstünde, ganz gleich, ob ihm nun ein fragwürdiger Großmachtstatus zukommt oder nicht, wird mehr Einfluss auf die globale Entwicklung haben als eine ewig über ihre Zipperlein klagende alte Tante. Wenn Europa wieder in Phönizien ankommt, dann mit offenen Händen und als Botschafterin einer auf friedliche Kooperation und fairen Ausgleich bedachten Politik. So würde eine Figur entstehen, die den ein oder anderen Maler dann doch zu einem neuen Frühlingsbild inspirieren könnte.